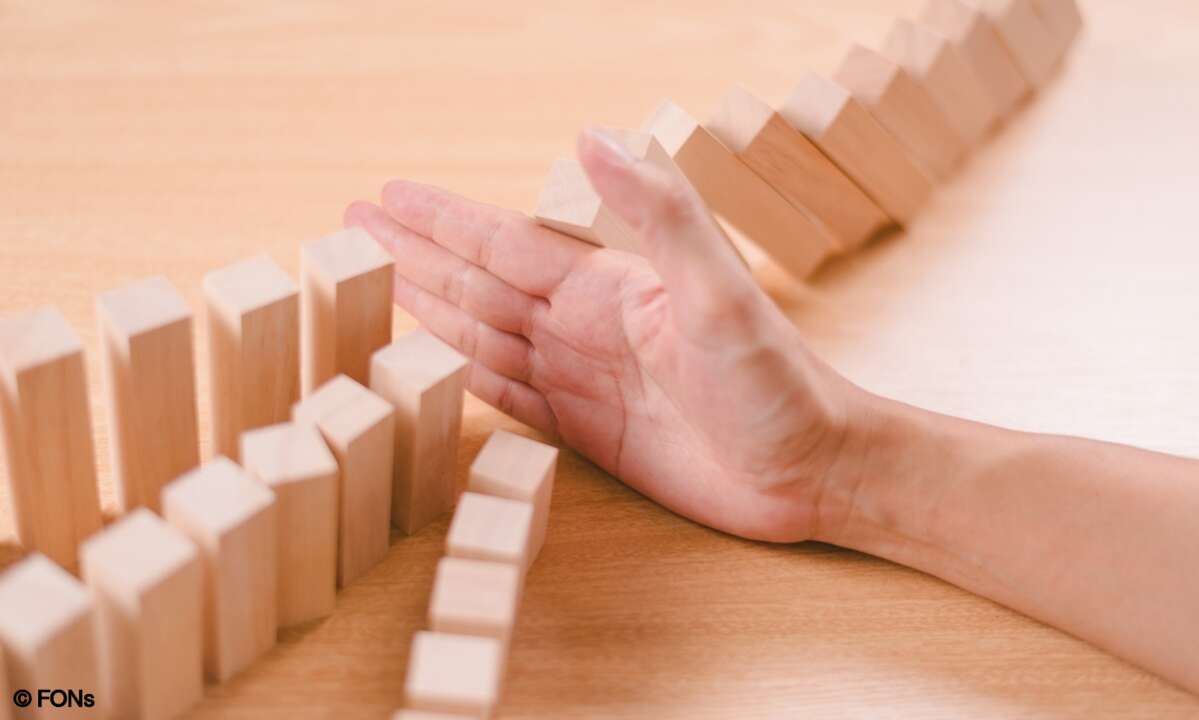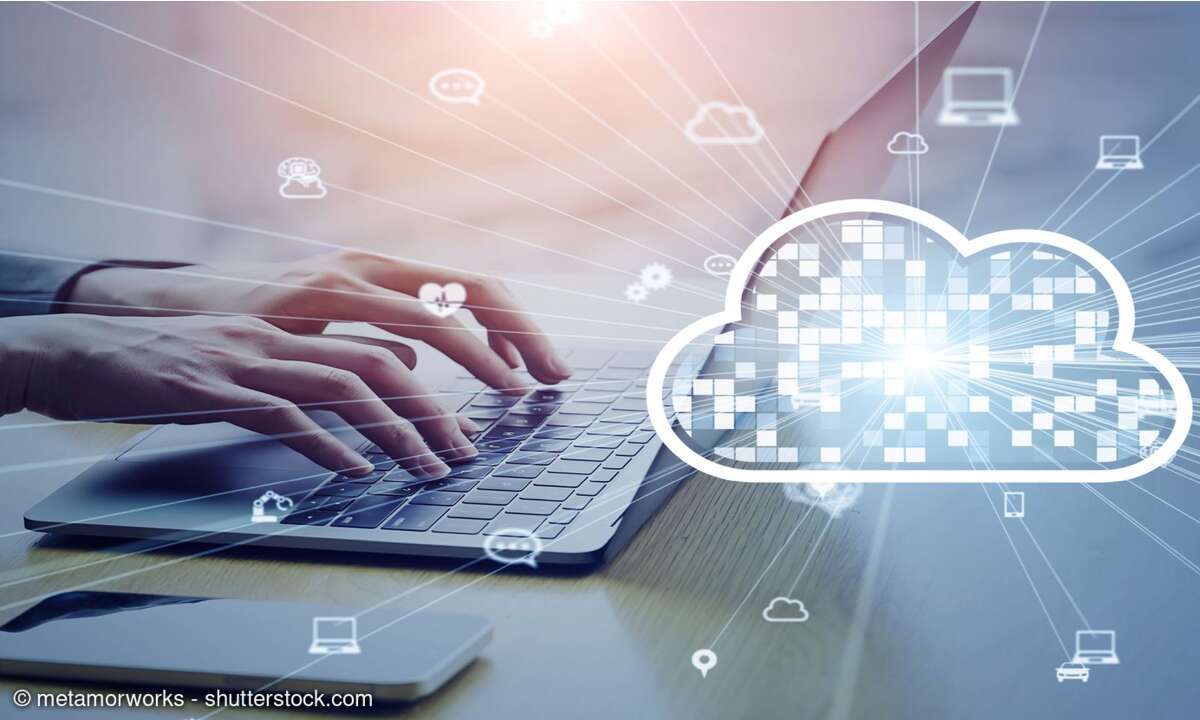Vorsicht bei Dienst- oder Werkverträgen
- So schützen Sie sich vor Abwerbern und Ausspannern
- Vorsicht bei Dienst- oder Werkverträgen
- Für und Wider von Vereinbarungen
Eine andere Situation entsteht dann, wenn der Vertragspartner eines Arbeitgebers Mitarbeiter abwirbt – beispielsweise wenn ITSpezialisten im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen beim Auftraggeber arbeiten und er ihn einstellen möchte. Im umgekehrten Fall kann aber auch ein IT-Dienstleister Gefallen an den Mitarbeitern seines Auftraggebers finden und sie für seine Firma abwerben. Gerade Behörden, die ihre IT-Spezialisten oft nicht marktgerecht bezahlen können, fürchten diese »Ausspann- Attacken« der IT-Firmen.
Jedoch postuliert § 241 Abs. 2 BGB, dass das Vertragsverhältnis neben der Erfüllung der Hauptleistung auch zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des jeweils anderen Vertragsteils verpflichtet. Dabei nimmt diese Rücksichtspflicht mit der Stärke der Bindung der Vertragsparteien zu. Das heißt: Haben die Vertragsparteien lediglich auf der Grundlage eines Kaufvertrages miteinander zu tun gehabt, sind die Schutzpflichten relativ gering. Je länger aber ein Vertragsverhältnis dauert, zum Beispiel auf der Grundlage eines Dauerschuldverhältnisses (Dienst-, Miet- oder Werkvertrages), desto länger wird die Liste der gegenseitigen Rücksichtspflichten.
Was für Kunden des Vertragspartners gilt, muss auch für Mitarbeiter des Auftraggebers oder Auftragnehmers gelten. Im IT-Bereich ist das Interesse am Erhalt seines qualifizierten Mitarbeiterstammes mindestens so hoch wie das Interesse am Erhalt des Kundenstammes. Verletzt ein Vertragspartner eine solche Nebenpflicht des Vertrages auf Rücksichtnahme, kann er gemäß § 280 BGB i. V. mit § 1004 BGB auf Unterlassen und gemäß § 280 BGB bei Verschulden auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses enden auch die Rücksichtspflichten der Vertragspartner. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen wird eine solche nachvertragliche Pflicht aus dem Gebot von Treu und Glauben gemäß §242 BGB vermutet. Ein nachvertragliches Abwerbungsverbot kann zum Beispiel angenommen werden, wenn der Zweck des Vertrags durch das Abwerben von Mitarbeitern nachträglich vereitelt wird. Das Gesetz bietet daher bei der Abwerbung von Mitarbeitern nur dann zuverlässig Schutz, wenn die Abwerbung während einer laufenden Vertragsbeziehung geschieht. Will ein Auftraggeber oder ein Auftragnehmer nach Beendigung eines Vertrages gegen das Ausspannen seiner Mitarbeiter gefeit sein, dann bieten sich vertragliche Abwerbeverbote an.
Nicht durchsetzbar sind allerdings Vereinbarungen, bei denen sich Arbeitgeber gegenseitig verpflichten, keine Arbeitnehmer des jeweils anderen einzustellen (§ 75 f HGB). Grund: Arbeitnehmer sollen ihrenArbeitsplatz frei wählen können, dürfen nicht durch Sperrabreden zwischen Unternehmern an ihrem beruflichen Fortkommen behindert werden. Zudem kann es nach § 138 BGB sittenwidrig sein, solche Sperrabreden zu tätigen, wenn die Absprache sittenwidrigen Zwecken dient, etwa dazu, die Gehälter in einer bestimmten Sparte einzufrieren. In einem Vertrag kann daher die Einstellung des Arbeitnehmers bei dem Vertragspartner nicht wirksam vereinbart werden.