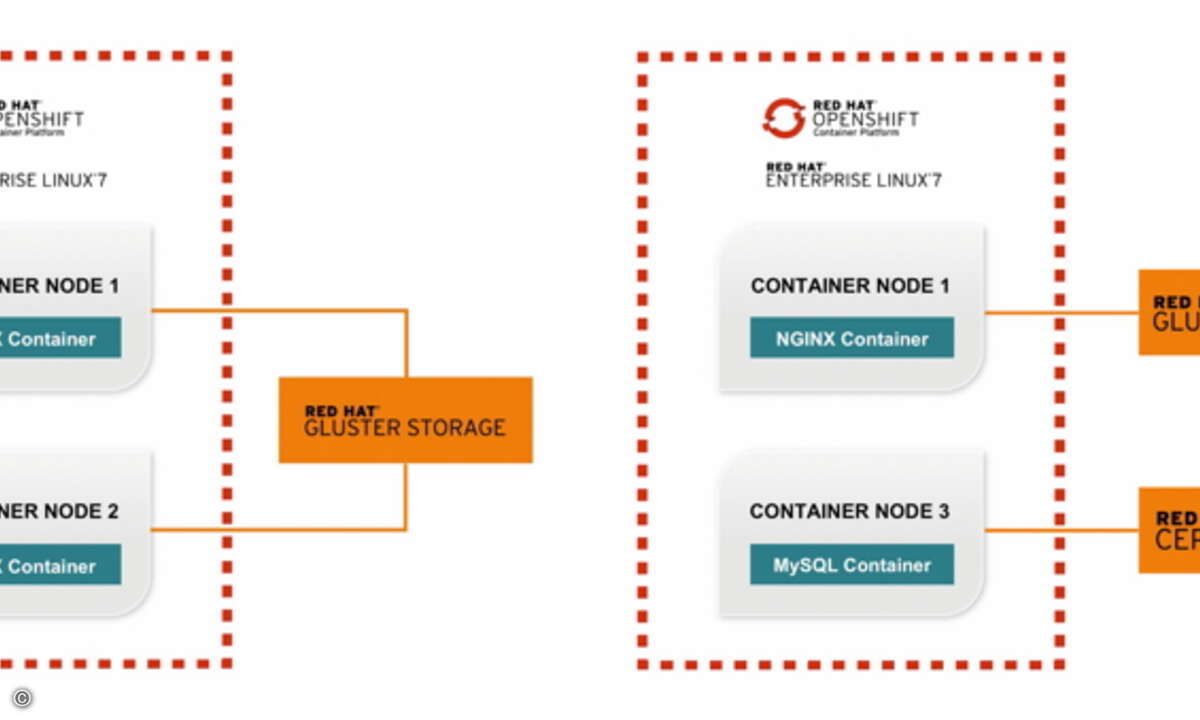Speicher nutzen nach Bedarf (Fortsetzung)
- Speicher nutzen nach Bedarf
- Speicher nutzen nach Bedarf (Fortsetzung)
SoD verhindert Speicherengpässe
In vielen Unternehmen wird Speicher noch immer erst dann bei der IT-Abteilung angefordert, wenn akuter Bedarf besteht. Im Extremfall reagiert ein unerfahrener Anwender erst, wenn eine Anwendung still steht. Verschärft wird das Problem durch die teils sehr langen Beschaffungszeiten.
Um Engpässe aus diesen Gründen zu verhindern, bieten sich SoD-Lösungen externer Betreiber an. Wer allerdings SoD einsetzen möchte, benötigt als Grundvoraussetzung eine konsolidierte IT-Infrastruktur, die sich mit Speicher in SANs oder NAS versorgen lässt. Die Konsolidierung an sich verlangt in der Regel konzeptionellen Aufwand und Investitionen, was für Anwender ein Hindernis darstellen kann. Um das Storage-System überwachen zu können, braucht der Dienstleister zudem eine elektronische Anbindung an das Storage-System des Kunden ? etwa über ein VPN (Virtual Private Network). Da nur wenige Daten übertragen werden, genügt hier auch schon ein Modem- oder ISDN-Zugang.
Durch das konsolidierte Storage-System kann der Provider Ressourcen poolen, um Speicherengpässe schnell zu beseitigen. Dabei wird ein gewisses Maß an freiem Plattenplatz vorgehalten, aus dem sehr kurzfristig Platzanforderungen bedient werden können. Das verkürzt die Beschaffung. Ausfallzeiten aufgrund von Speicherplatzmangel lassen sich so vermeiden.
Zusätzliche Hardware für darüber hinaus gehende Speicherkapazitäten kann der Service Provider innerhalb eines vereinbarten Rahmens kurzfristig bereitstellen. Er überwacht dazu die Speichernutzung permanent und erkennt kritische Tendenzen, zum Beispiel, wenn die Schwankungsreserve über einen längeren Zeitraum ständig voll ausgelastet ist.
Service-Level beim SoD
»SoD ist nicht auf bestimmte Anwendergruppen, Unternehmensgrößen oder Branchen begrenzt«, sagt Oliver Wicklandt, Senior Business Developer, Competence Center Server & Storage Solutions bei Siemens Business Services. Besonders interessant ist das Verfahren für mittelständische und Großunternehmen mit variablem Speicherbedarf ? etwa bei Quartals- und Jahresabschlüssen oder in Konsolidierungsprojekten.
Entscheidet sich ein Unternehmen für SoD, ist es besonders wichtig, mit dem Provider Service Level Agreements (SLAs) zu vereinbaren. »Speicherlösungen haben immer auch Service-Charakter. Denn die Lösung muss immer auf die Prozesse des Kunden abgestimmt werden«, erklärt Wicklandt. In den SLAs sollten folgende Kriterien eindeutig geklärt sein:
- Hardware-Redundanz,
- Notfallplanung,
- Sicherheit der Kundendaten,
- Kriterien für die verlangte Performance,
- Kompensation für Ausfälle,
- Skalierungsmöglichkeiten und Bandbreiten.
Welche Anforderungen der Speicher erfüllen muss, lässt sich anhand definierter Datenklassen festlegen. Die Informationen, die in einem Unternehmen anfallen, sind dafür nach mehreren Kriterien zu bewerten ? zum Beispiel nach Kosten eines Datenverlusts oder nach Konsequenzen bei Nichtverfügbarkeit. Datentypen mit gleichen Anforderungen an die Sicherung und Archivierung werden in einer Klasse gesammelt und in derselben Speicherhierarchie abgelegt.
Aus den intern festgelegten Datengruppen lassen sich übergreifende Storage-Klassen ableiten. Diese können etwa über die Art der Anwendung definiert werden. Unterscheidungskriterien sind die Wichtigkeit der Applikation und die damit einhergehenden Verfügbarkeitsanforderungen. Auch die Performance des Plattenplatzes und dessen Funktionalität sowie gesetzliche Bestimmungen oder Zugriffszeiten können als Klassifizierungsmerkmal dienen.
Wie diese Storage-Klassen aussehen können, zeigt ein Beispiel von Siemens Business Services. In der Basic-Kategorie steht den Unternehmen möglichst kostengünstiges Speichervolumen für Test- oder temporäre, leicht wieder zu erzeugende Daten zur Verfügung. Unterbrechungsfreie Hochverfügbarkeit ist dabei jedoch nicht gewährleistet. Die Advanced-Klasse umfasst günstiges Storage-Volumen in Verbindung mit Services Level Agreements und speichert Daten mittlerer Wichtigkeit. Dazu gehört hohe Ausfallsicherheit durch redundante Geräte. Die Premium-Kategorie, in der etwa Produktivdaten verwaltet werden, bietet die höchste Sicherheit und Performance.
Kosten teilen, gemeinsam profitieren
Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg von SoD-Projekten liegt in den Personalkosten. Unternehmen, die ihre Storage-Systeme selbst betreiben, müssen dafür Mitarbeiter bereitstellen.
Der externe Service Provider dagegen kann die Personalkosten auf mehrere Kunden umlegen. Zudem teilen sich bei SoD in der Regel mehrere Unternehmen den Aufwand für die Konzeption, die Beschaffung und das Management. Kurzfristig ergeben sich weitere Vorteile bei Cash-flow und Bilanz durch den verringerten Investitionsbedarf.
Aufgrund von Skaleneffekten kann der Storage Provider Geräte, Software-Lizenzen und Services oft günstiger zur Verfügung stellen. Die Kunden übertragen die Betriebs- und Planungsverantwortung auf den Dienstleister, der somit auch das technische und operationale Risiko übernimmt. Stefanie Machauf ist freie Journalistin in München.