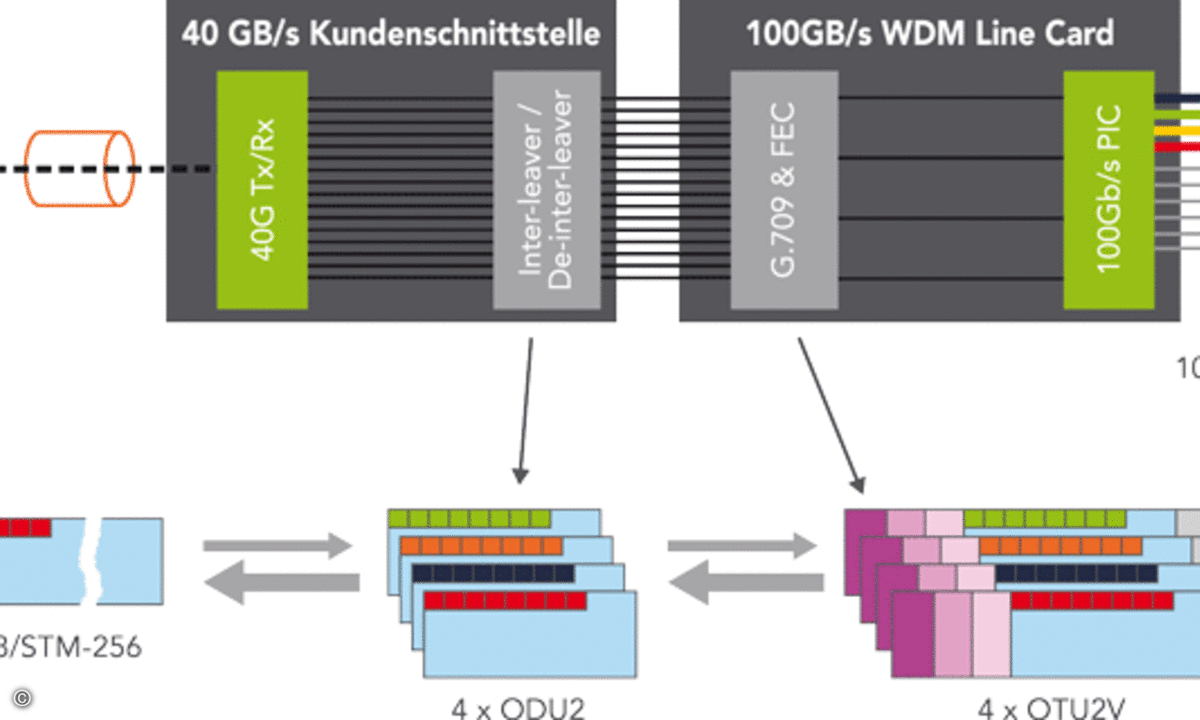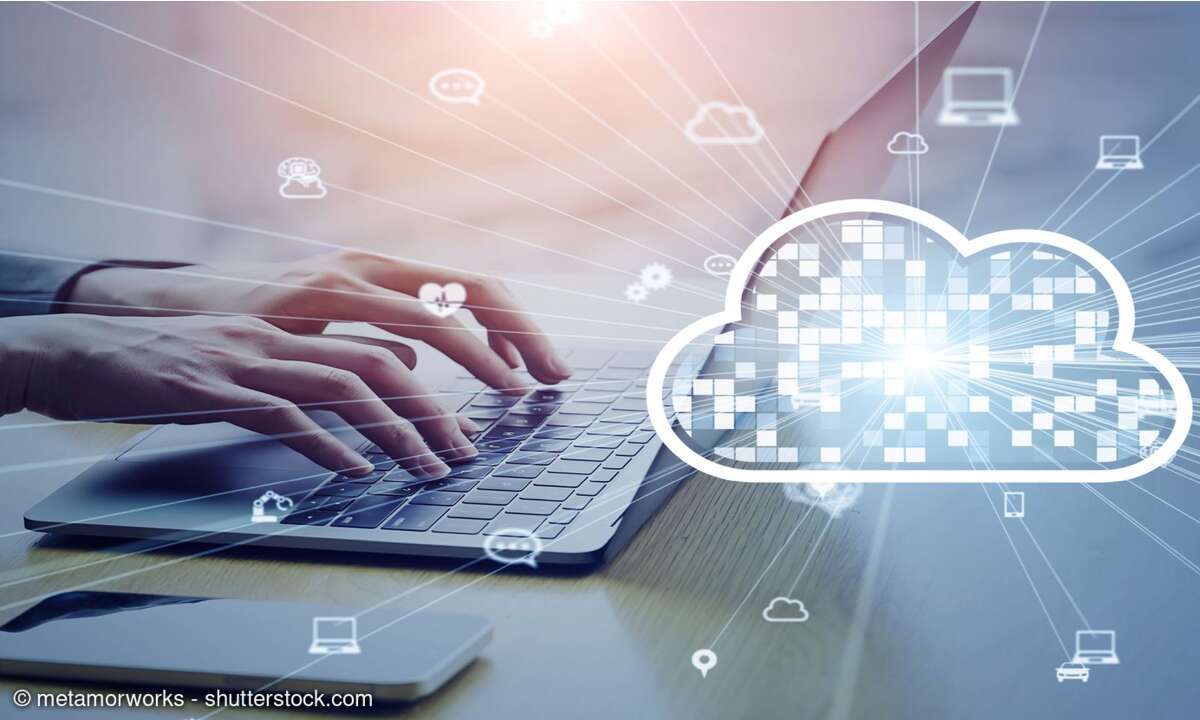Flexibilität auf der Datenautobahn
Der IP-gestützte Datenverkehr wächst ungebremst. Die jährlichen Steigerungsraten schätzen anerkannte Stellen auf 75 bis 125 Prozent. Daraus ergeben sich zahlreiche Herausforderungen für Betreiber moderner Netzwerke. Längst geht es nicht mehr allein darum, mit den hohen Datenvolumen Schritt zu halten.Das Volumen der zu übertragenden Daten schwankt immer mehr. Der Anteil dieses vorübergehenden Bedarfs nimmt im Vergleich zum statischen Bedarf zu. Dafür sind die verschiedensten Datentypen verantwortlich, wie on-demand abrufbare zentral gespeicherte Daten oder auch wichtige außergewöhnliche bandbreitenintensive Ereignisse innerhalb der Cloud, wie etwa die Migration einer oder mehrerer Datenbanken. Bei der Planung, Einrichtung und beim späteren Wachstum des Netzwerks steigen daher die Anforderungen an die Flexibilität der Infrastruktur. Notwendig ist daher die Loslösung von klassischen Netzwerkinfrastrukturen, die Datenübertragungskapazität starr zuweisen. Gefordert ist die flexible Zuteilung von Bandbreite aus dem Gesamtpool der zur Verfügung stehenden Wellenlängen je nach Bedarf - eine Virtualisierung der Ressource "Bandbreite". WDM und ROADM Die bisher starre Zuteilung von Wellenlängen und damit von Bandbreitenkapazitäten in Standardtechniken wie WDM und ROADM sind für solche dynamischen Aufgaben nicht ausgelegt. Flexibilität ist hier ein teures Gut. In einem konventionellen transponderbasierenden WDM-Netzwerk macht etwa ein neuer Service eines Netzbetreibers die Verbindung der Kundenschnittstelle - zum Beispiel eines 10GBit/s-Ports eines IP Routers - an einen Transponder nötig, der den Dienst auf einer festen Wellenlänge im optischen Netzwerk überträgt (Bild 1). Jeder Dienst ist also fest auf einer spezifischen Wellenlänge lokalisiert. Analoge optische Netzwerkeinrichtung und die notwendige Einrichtung von Hardware für eine erfolgreiche End-to-End-Datenübertragung verlangsamen die zusätzliche Einrichtung neuer Bandbreitenkapazität. Die Anpassung der Bandbreite an di