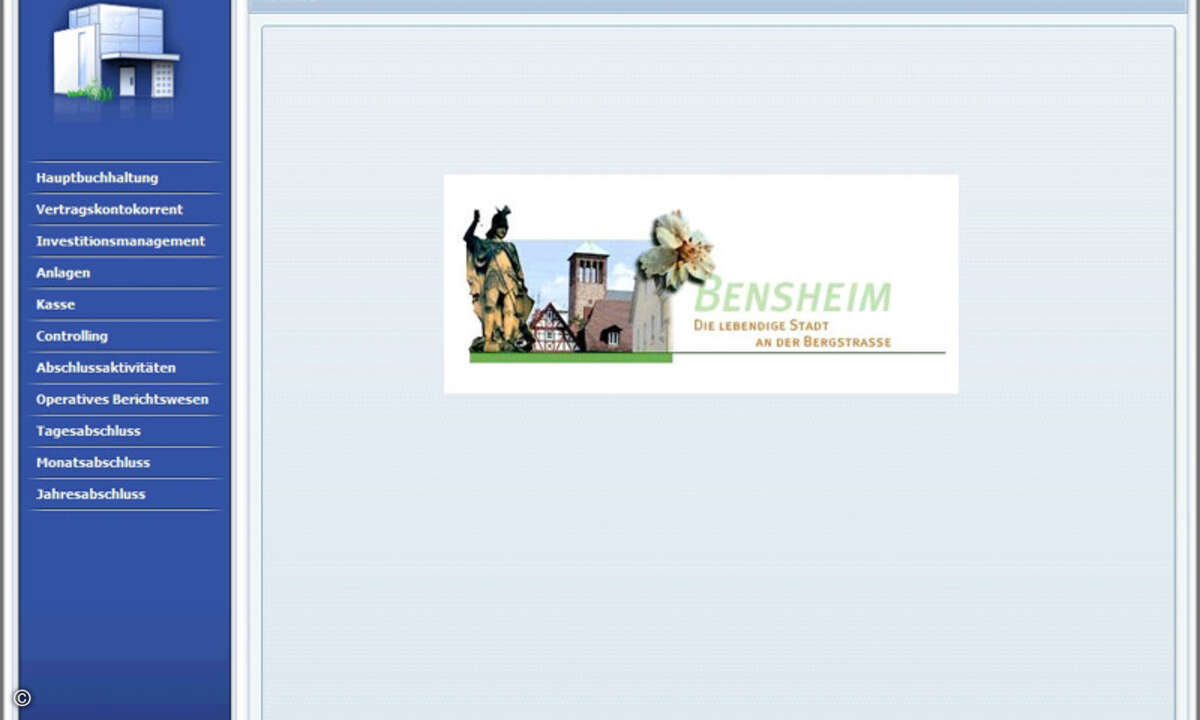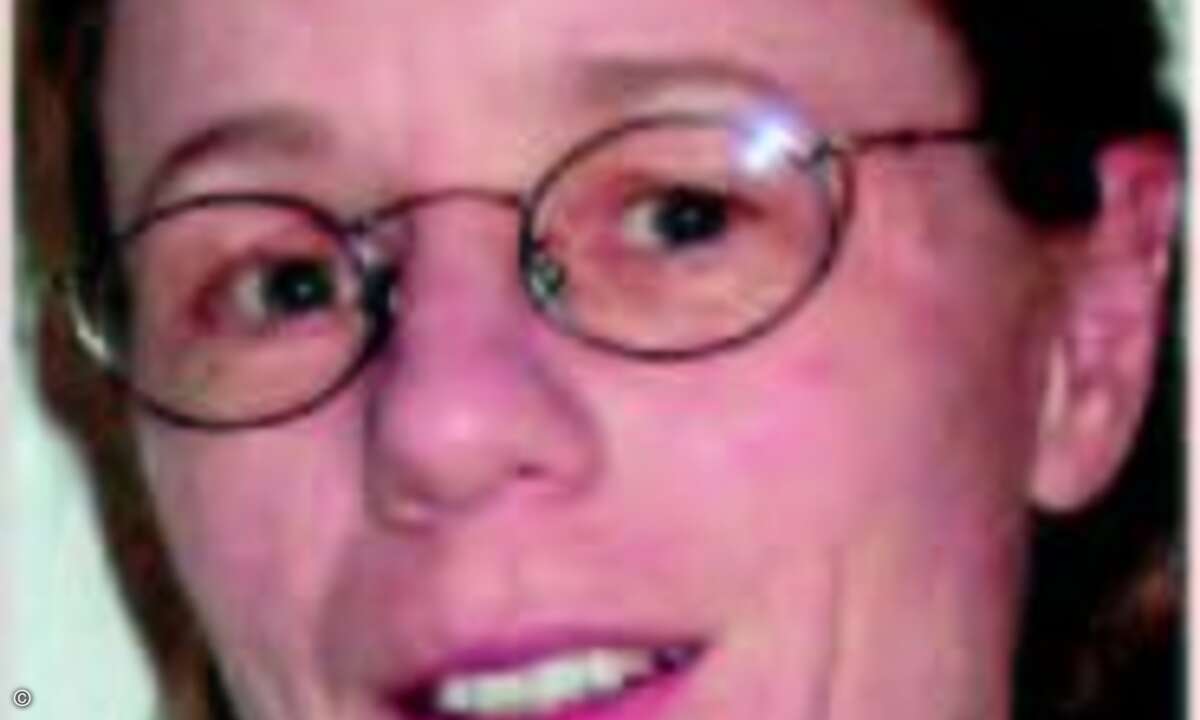Ein bisschen Doppik funktioniert nicht
Ein bisschen Doppik funktioniert nicht Die Einführung der Doppik birgt unzweifelhaft Vorteile für Kommunen. Die mit dem kaufmännischen Rechnungswesen verbundene Transparenz der wirtschaftlichen Lage und die Möglichkeiten zur betriebswirtschaftlichen Erfolgs- und Vermögensrechnung verbessern die wirtschaftliche Steuerbarkeit.

- Ein bisschen Doppik funktioniert nicht
- Versteckter Mehraufwand
- Klare Vorstellungen führen auch zum Erfolg
Bei manchen Städten und Gemeinden herrscht immer noch Ratlosigkeit, weil sich die erwarteten Steuerungserfolge nach der Umstellung auf die Doppik nicht wie erwartetet einstellen. Wer daraus ein Versagen der Doppik an sich ableiten will, zieht aber die falschen Schlüsse – da sind sich Experten einig. Der Umstieg muss als Neubeginn verstanden und darf nicht halbherzig angegangen werden, dann lassen sich die Vorteile der Doppik auch realisieren. Der Nürnberger IT-Dienstleister DATEV eG, mit Spezialisierung auf kommunale Belange, hat bereits mehrere Umstellungen auf das kaufmännische Rechnungswesen vorbereitet und begleitet. Alle Anwender aus diesen Projekten berichteten anschließend von positiven Auswirkungen des Umstiegs. Wo die Steuerungseffekte ausbleiben, sehen Fachleute die Probleme in der Regel als hausgemacht. Vielfach existiert eine Sehnsucht, das gewohnte Steuerungsprinzip nicht grundlegend aufzugeben. Dass manche Software-Hersteller ihr Verfahren der Haushaltssteuerung trotz Doppik beibehalten, leistet dieser Haltung Vorschub. Wird die Doppik aber nicht als kompletter Systemwechsel angegangen, verpuffen die nötigen Investitionen. »Bei der Umstellung geht es darum, eine neue kommunale Steuerungsphilosophie zu schaffen«, bekräftigt auch Dieter Freytag, Kämmerer der nordrhein-westfälischen Stadt Brühl, die bereits seit 2005 kaufmännisch bucht. »Ein solches Vorhaben gelingt nur mit sehr viel Engagement und bedingt selbstverständlich Entwicklungsaufwand.« Den sogenannten »weichen Umstieg« betrachtet man bei der DATEV daher als ein fragwürdiges Konstrukt. Besonders bizarr ist vor allem die Tatsache, dass dieser Terminus inzwischen nicht nur von manchen Anbietern propagiert wird, sondern sich sogar in offiziellen Thesen-Papieren einzelner Länder findet. Tatsächlich wird damit lediglich den latenten Ängsten vor der Veränderung begegnet und der Kommune eine scheinbare Wahlmöglichkeit vorgegaukelt. Das Versprechen lautet, dass methodisch die vertraute Kameralistik betrieben werden könne, während gleichzeitig die Doppik gewissermaßen »im Hintergrund« mitläuft. Billigend in Kauf genommen wird dabei, dass diese halbherzige Umsetzung auf Kosten der wirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten geschieht. Die Strukturen einer Kosten- und Leistungsrechnung und einer Anlagenwirtschaft lassen sich zwar durchaus unabhängig von der Doppik schaffen. Solange die Datengrundlage noch kameral ist, wird das Ergebnis aber nie doppisch sein. Praxisbeispiele zeigen denn auch, dass Kommunen, die sich für den »weichen Umstieg« entschieden haben, die kamerale Datenbasis oft über Jahre nicht überwinden und somit auch keine Steuerungserfolge verbuchen können. Sie praktizieren gewissermaßen eine Schein-Doppik. Profitieren kann davon niemand wirklich. Um zu einer doppischen Steuerung zu gelangen, kommen Kommunen um den endgültigen Umstieg auf das doppische Verfahren nicht herum. Die beste Lösung aus Sicht der Verwaltung muss dabei diejenige sein, die bei gleichen Kosten und gleicher Arbeitsbelastung zu einer besseren Motivation der Mitarbeiter führt, beziehungsweise Kosten und Arbeitsbelastung möglichst gering hält. Während der Begriff »weicher Umstieg« lediglich eine zeitlich verzögerte Umstellung suggeriert, ist diese Art des Umstiegs aber in der Regel mit einer deutlich erhöhten Arbeits- und Kostenbelastung verbunden.