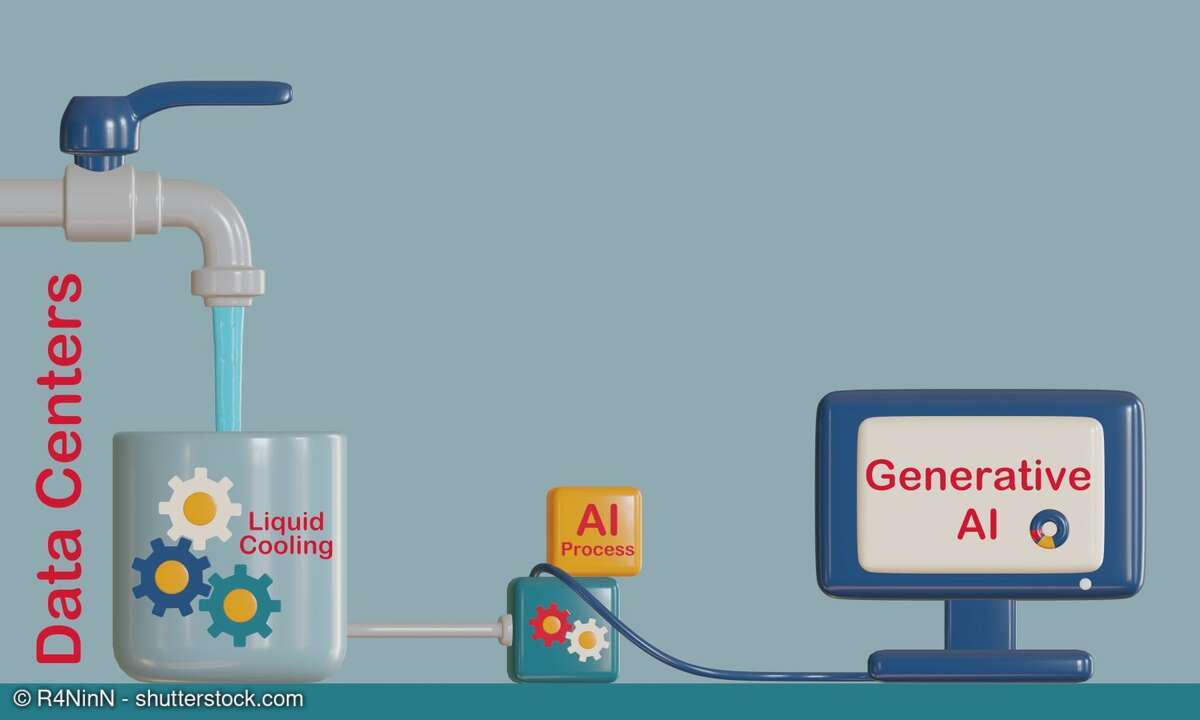Nachhaltigkeitsaspekte im Rechenzentrum
Der Energiebedarf in Rechenzentren ist nicht nur wegen der zuletzt gestiegenen Strompreise in den Fokus gerückt, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit. Ob IT-Architektur, Handware-Einsatz oder Security – es gibt viele Stellschrauben für nachhaltige Rechenzentren.

Rechenzentren gelten in vielerlei Hinsicht als Klimasünder. Zum Beispiel sind sie in der EU bis 2030 für 3,2 Prozent des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich. Dabei tragen gemäß einer Cisco-Studie die Server und Storage 26 Prozent des Stromverbrauchs im Datacenter bei. Aber auch Wasserbedarf, Kühlaufwand und Komponenten aus umweltschädlichen Materialien trüben die Bilanz. So benötigen Kühlung und Rack-Betrieb rund die Hälfte der Energie im Rechenzentrum. Zusätzlich steigt mit der zunehmenden Datenflut der Ressourcenbedarf weiter an. Entsprechend müssen Unternehmen Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit entwickeln.
Anbieter zum Thema
Ressourcen effizient einsetzen
Der erste Blick geht hier meist in Richtung Energieverbrauch. Denn dieses Thema bietet gleich zwei wesentliche Vorteile: direkte Kostensenkung und Vermeiden von CO2-Ausstoß. Am einfachsten können dies Unternehmen meist durch den Austausch älterer Komponenten und Lösungen erreichen. Denn moderne Server-Hardware, Storage-Technologien oder Router und Switches für das Datacenter und Enterprise Network sind meist wesentlich energieeffizienter. Das bedeutet mehr Leistung bei weniger Strombedarf.
Außerdem bieten sie häufig mehr Funktionen und flexiblere Optionen. So stellen sie integrierte Netzwerkdienste nach Bedarf bereit. Neben dem reinen Eins-zu-Eins-Austausch können Unternehmen ihre Energiebilanz weiter verbessern, indem sie bisherige Systeme konsolidieren und virtualisieren. So wird die Hardware besser ausgelastet. Da weniger Komponenten nötig sind, reduziert dies den Energiebedarf im Rechenzentrum. Geeignete Software-Lösungen für das Management können die Effizienz weiter erhöhen, indem sie zum Beispiel automatisch die Workloads optimal verteilen. Gerade in Zeiten von Hybrid Work und virtueller Collaboration müssen Unternehmen hier flexibel bleiben.
Architekturmodell modernisieren
Der nächste Schritt besteht häufig in der Modernisierung des Architekturmodells. Dabei sollten Unternehmen zuerst prüfen, ob ein Server nur unwichtige oder kaum genutzte Anwendungen hostet. Die Applikationen lassen sich dann entfernen oder auf andere Server verlagern, um die nicht mehr benötigte Hardware abzuschalten. Durch permanente Messungen der Auslastung weisen Management-Lösungen den Anwendungen dann nur die zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Ressourcen zu.
Integrierte Systeme aus Server, Speicher und Netzwerk verbessern das Architekturdesign ebenfalls. Sie bieten richtlinienbasiertes Management zur automatischen Bereitstellung sämtlicher Anwendungen, inklusive Virtualisierung und Cloud Computing. Das konsolidierte Hardware-Paket ermöglicht Überbuchung, um den Ressourcenverbrauch weiter zu reduzieren. Dies funktioniert ähnlich wie ein Schaltschrank.
Modulare Systeme einsetzen
Modulare Blade-Systeme können statt dedizierter Rack-Server zum Einsatz kommen. Dies reduziert die installierte Hardware und erhöht die Flexibilität. So besitzen Racks jeweils zwei Netzteile (PSU) und Kabel, eigene Zusatzmodule sowie eine fest installierte Kühlungs- und Stromversorgung. Dagegen nutzen modulare Systeme nur sechs PSUs für acht Server sowie ein Kabel für Daten-, Storage- und Managementverkehr. Virtualisierte NICs (Network Interface Cards) und HBA (Host Bus Adapter) vermeiden weiteren Verkabelungsaufwand. Zusätzlich senken Leistungsbegrenzung und Kühlungsregeln den Energiebedarf.
Die flexible Nutzung der Hardware-Ressourcen basiert auf permanenten Messungen der aktuellen Anforderungen. Weitgehend automatische Anpassungen vermeiden Engpässe und Ressourcenverschwendung im laufenden Betrieb. Intelligente Software übernimmt dabei die Steuerung und Überwachung der Datacenter-Umgebung. Und in Spitzenzeiten erlauben geeignete Schnittstellen und Lösungen eine schnelle Integration mehrerer Cloud-Anbieter.
Security zukunftssicher aufstellen
Moderne, konsolidierte Ansätze dürfen dann aber nicht im laufenden Betrieb schleichend erodieren. Dies geschieht insbesondere durch die Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen aufgrund neuartiger Angriffe. Jede zusätzliche Hardware-Appliance oder virtuelle Instanz erhöht dann wieder den Stromverbrauch. So sollten Unternehmen Router und Switches mit integrierten Security-Funktionen nutzen. Allerdings müssen sich diese flexibel anpassen, aktualisieren und erweitern lassen, um zukunftsfähig zu sein. Denn niemand weiß, wie sich die Angriffsmethoden weiterentwickeln.
Entsprechend sind einzelne Zusatzlösungen möglichst zu vermeiden, da diese einen unübersichtlichen, ineffizienten Flickenteppich erzeugen. Deutlich nachhaltiger ist das Überprüfen der mit dem Enterprise Network verbundenen Geräte auf Authentizität und Integrität. Damit lassen sich nicht autorisierte Zugriffe erkennen und vermeiden. Zudem können Unternehmen feststellen, ob sich die Geräte von ihrem Herstellungszustand unterscheiden und diese so funktionieren, wie sie sollen. Ein integrierter TAm-Chip bietet dazu Laufzeit-Schutz sowie ein sicheres Booten und Signieren von Images.
Komponenten wiederverwenden
Einen wichtigen Punkt für mehr Nachhaltigkeit bildet das Vermeiden von Abfall. Doch ältere Geräte möglichst lange weiterlaufen zu lassen, ist nicht immer die Lösung. Denn sie verbrauchen in der Regel mehr Strom und weisen häufig Sicherheitslücken auf, vor allem nach Ablauf des Wartungszeitraums. Selbst in unkritischen Bereichen können sie dann ein gefährliches Einfallstor ins Unternehmen für Cyberkriminelle öffnen.
Sicherer und zuverlässiger sind dagegen wiederaufbereitete Geräte. Da sich die Nutzung umweltschädlicher Schwermetalle und anderer Materialien in IT-Komponenten nicht ganz vermeiden lässt, kommen sie hier weiterhin zum Einsatz und landen nicht im Müll. Zudem bieten diese Geräte aktuelle Security-Funktionen und hohe Ausfallsicherheit. Manche Hersteller ermöglichen Unternehmen die vollständige Rückgabe ihrer Datacenter-Geräte und anderer Produkte. Die Materialien aus den zurückgegebenen Geräten werden dann wiederverwertet, zum Teil verbleiben sie sogar in den Refurbished-Produkten.
Kühlbedarf senken
Die Kühlung gehört zu den größten Stromfressern im Rechenzentrum. Daher lohnt es sich, hier effiziente Abläufe einzuführen. Eine einfache Möglichkeit ist eine höhere Betriebstemperatur der Komponenten. Dies reduziert zwar den Kühlbedarf, kann aber gleichzeitig deren Lebensdauer beeinträchtigen. Das bedeutet: Die Komponenten laufen heiß und fallen dadurch früher aus. Ähnliches gilt für die Auslastung. Eine Überlastung senkt den Strombedarf, da weniger Komponenten aktiv sind, verkürzt jedoch ebenfalls die Betriebsdauer. Der verantwortliche Betreiber muss hier eine Balance finden.
Aufwändiger, aber nachhaltiger ist ein verändertes Kühlkonzept. Zum Beispiel nutzt die freie Luftkühlung den Außenwind. Obwohl die Außenluft gefiltert und meist befeuchtet werden muss, senkt dies – je nach Standort – deutlich den Energiebedarf. Bei der häufig bereits eingesetzten Warm- und Kaltgangeinhausung sind die Rack-Reihen so ausgerichtet, dass die Server mit der Rückseite zueinanderstehen. Die Gänge bleiben geschlossen, um die kalte Luft weitgehend zu behalten. Notwendige und adaptive Luftströme dürfen nicht durch Hindernisse beeinträchtigt werden. Zur weiteren Verbesserung der Bilanz lässt sich die von den Servern erzeugte Wärme zur Aufheizung von nahegelegenen Büros, Wohnungen oder gemeinnützigen Einrichtungen wie Schwimmbädern nutzen.
Rechenzentren richtig aufbauen
Unternehmen sollten auch die Gebäudeeigenschaften ihrer Rechenzentren prüfen. So kann bereits der Ort die Nachhaltigkeit deutlich erhöhen. International tätige Unternehmen sollten ihre Datacenter nach Möglichkeit an kühlen Orten wie in Skandinavien oder Kanada errichten. Schon durch die kältere Umgebung und die Nutzung der Außenluft benötigen sie weniger Energie für die Kühlung. Zusätzlich müssen die Planer darauf achten, dass möglichst viel Strom aus erneuerbaren Energien stammt, etwa Wind- und Wasserkraft.
Uwe Müller ist Head of Sales & PreSales Datacenter bei Cisco Deutschland