Datacenter-Ausrüstung: KVM-Switches
Buyer’s Guide KVM-Switches – Umschalter für jeden Zweck
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Rack-Systeme für große Installationen
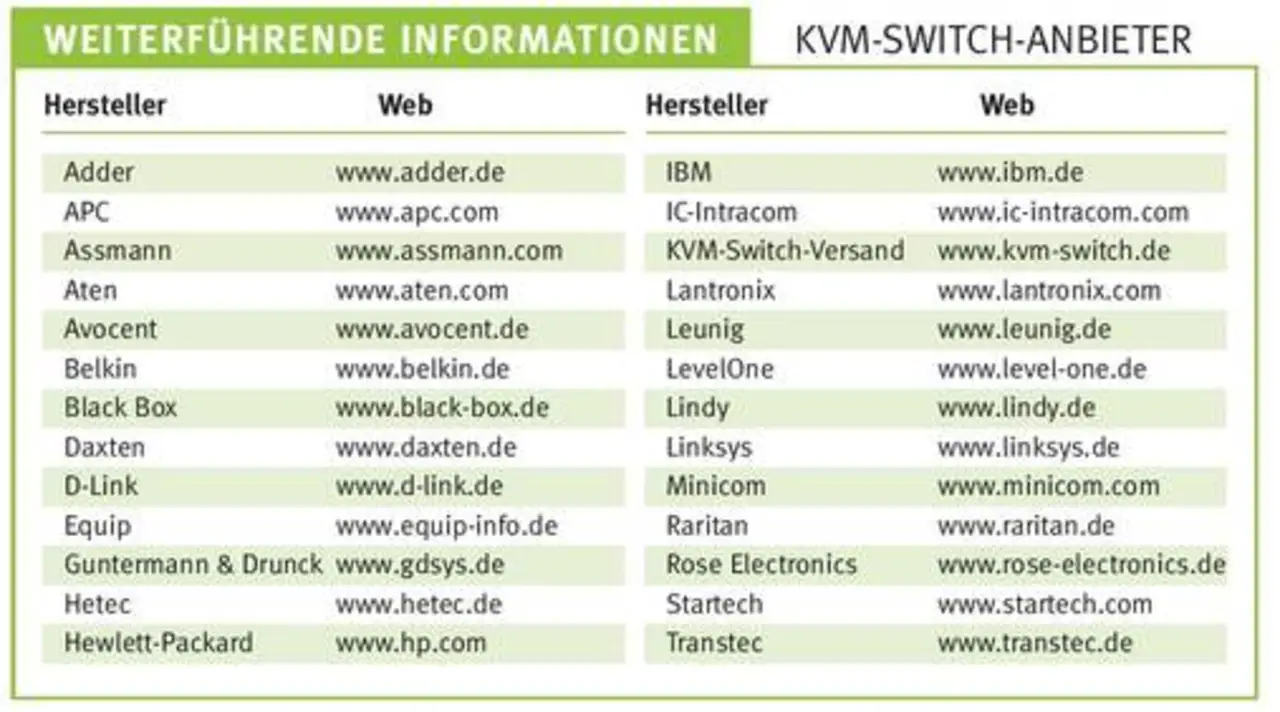
Besonders für den Einsatz in größeren Organisationen eignen sich KVM-Switches, die sich in 19-Zoll-Schränke oder Racks installieren lassen. Solche Systeme unterstützen normalerweise zwischen 8 und 64 Computer, lassen sich aber durch Kaskadierung bis auf Tausende von ansteuerbaren Computer erweitern.
In der Regel erlauben diese Geräte den Anschluss mehrerer Arbeitsplätze; es handelt sich also um Matrix- oder Multi-User-KVM-Switches.
Obwohl einige dieser KVM-Switches eine Bedienung direkt am Gerät erlauben, beispielsweise über Tasten oder LCD-Anzeigen, und in einigen Systemen sogar eine vollständige Tastatur mit Zeigegerät und einem aufklappbaren Bildschirm integriert ist, erfolgt die Bedienung meistens via Hotkey oder OSD-Menü von entfernten Arbeitsplätzen aus.
KVM-Switches dieser Kategorie lassen sich meistens bis ins Detail konfigurieren. Sie bieten beispielsweise einen Passwortschutz und erlauben dem Administrator, genau einzustellen, wer auf welche Computer in welcher Weise zugreifen darf.
Um die Verwaltung zu vereinfachen, können Computer in Gruppen zusammengefasst werden. Einige Geräte unterstützen eine Konfiguration, in der der KVM-Switch automatisch zwischen zuvor ausgewählten Computern umschaltet.
Der KVM-Switch verweilt in diesem Fall bei jedem Rechner mehrere Sekunden lang, bevor er zum nächsten weiterschaltet. Diese Zeitspanne gibt der Administrator vor. Der kann das Weiterschalten jederzeit unterbrechen und sofort die Steuerung des gerade angezeigten Computers übernehmen.
Die maximale Entfernung zwischen einem zu steuernden Computer und dem KVM-Switch beträgt bei herkömmlichen KVM-Switches normalerweise maximal 20 Meter. Die Distanz zwischen einem Arbeitsplatz und dem Switch richtet sich danach, wie lang die Kabel des anzuschließenden Bildschirms, der Maus und der Tastatur sind.
Einige KVM-Switch-Hersteller erhöhen diese Entfernungen durch spezielle Verstärker oder zwischengeschaltete Anschlussboxen.
Ohne Entfernungsbegrenzung arbeiten KVM-Switches, die das Netzwerkprotokoll TCP/IP unterstützen (KVM over TCP/IP). Bei dieser modernen Variante eines KVM-Switches werden Tastatur, Maus und Bildschirm des Arbeitsplatzes nicht direkt am KVM-Switch angeschlossen. Stattdessen erfolgt die Weiterleitung der Bildschirmausgabe des gesteuerten Computers und der Tastatur- und Maussignale des Arbeitsplatzes über das TCP/IP-Netz.
Die Steuerung am Arbeitsplatz läuft über eine spezielle Anschlussbox, einen Web-Browser oder über eine KVM-Software. Die Variante ohne Anschlussbox bietet den Vorteil, dass die Fernsteuerung von einem beliebigen Arbeitsplatz im TCP/IP-Netzwerk aus und sogar über das Internet durchgeführt werden kann.
Hier drängt sich ein Vergleich zu herkömmlicher Remote-Control-Software wie PC-Anywhere oder auch mit Windows-Terminaldiensten auf, die oberflächlich betrachtet dasselbe leisten.
Aber KVM over TCP/IP ist im Gegensatz zu Remote-Control-Software nicht darauf angewiesen, dass auf dem zu steuernden Computer eine Remote-Control-Software läuft. KVM over TCP/IP setzt viel weiter unten an und erlaubt es beispielsweise, Änderungen der BIOS-Einstellungen der angeschlossenen Computer durchzuführen. Das ist mit einer Fernsteuer-Software nicht machbar.
KVM over TCP/IP erfordert naturgemäß einen höheren Setup-Aufwand als traditionelle KVM-Switches. Bei den letztgenannten Systemen ist es in der Regel mit dem Anschließen der Kabel bereits getan.
Hinzu kommt, dass gegebenenfalls ein Management- oder Authentifizierungs-Server zu installieren sind. Bei einigen KVM-over-TCP/IP-Systemen ist es zudem notwendig, auf den Arbeitsplatzrechnern, die sich mit dem KVM-Switch verbinden sollen, eine spezielle Software oder Web-Browser-Erweiterungen zu implementieren.
Bei KVM over TCP/IP ist besonders auf den Preis zu achten. Denn in einigen Fällen sind zusätzlich ein Management-Server und Lizenzen für die TCP/IP-Nutzung erforderlich, was den Preis deutlich in die Höhe treiben kann.
Dann gilt es abzuwägen, ob der Vorteil, mehrere Maschinen verbinden zu können, ohne auf dem Server zusätzlicher Software (beispielsweise PC-Anywhere) installieren zu müssen, den Preis rechtfertigt.
- Buyer’s Guide KVM-Switches – Umschalter für jeden Zweck
- KVM-Switch ist nicht gleich KVM-Switch
- Rack-Systeme für große Installationen





