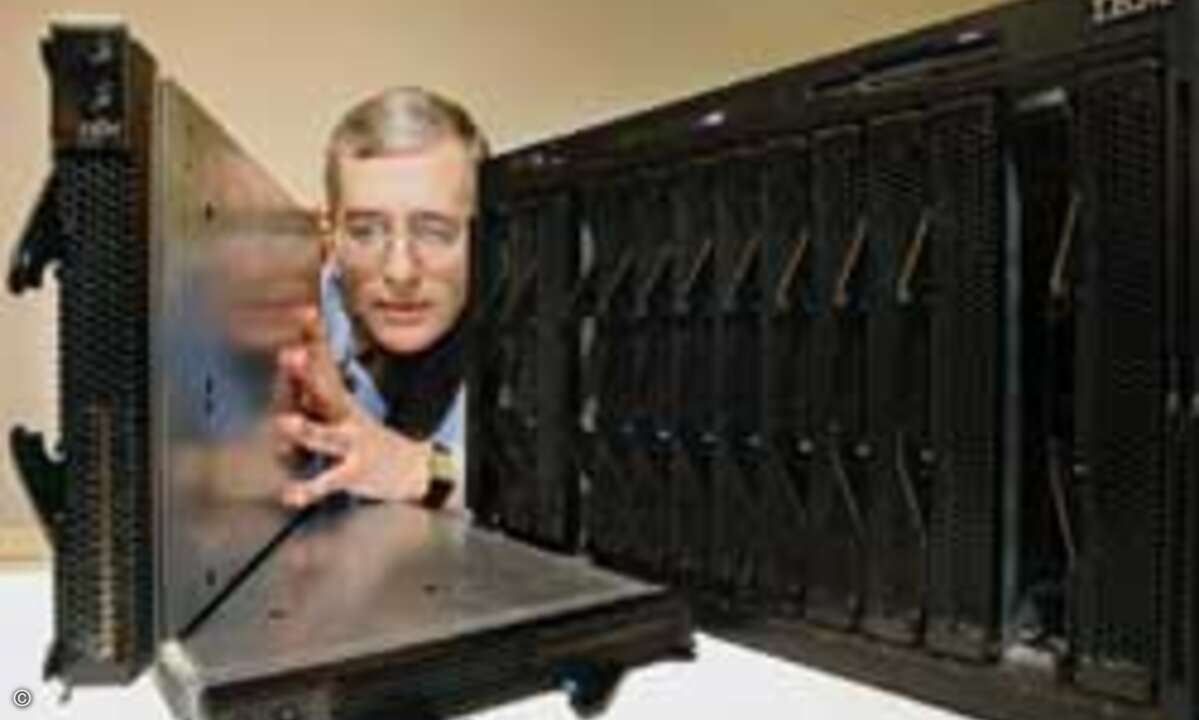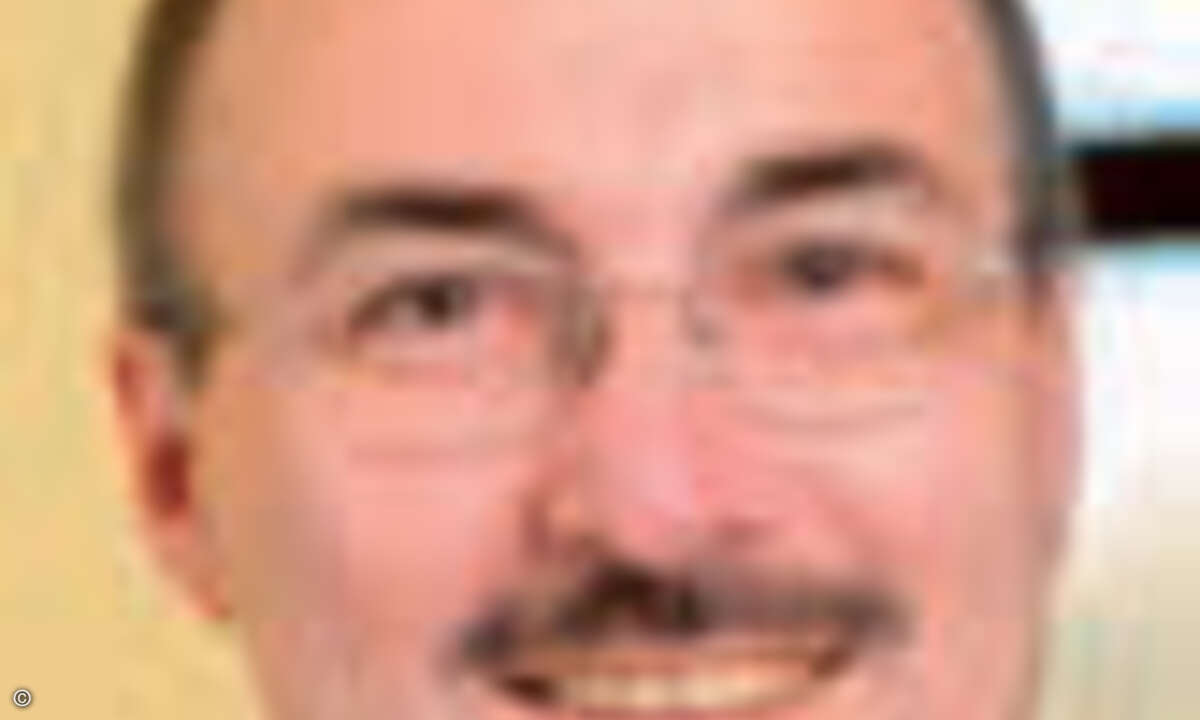Auf die Server kommt es an
Wie Personal- oder Fertigungskapazitäten sollte die IT in den Unternehmen heute möglichst optimal ausgelastet sein und keine wertvollen Kapazitäten brach liegen lassen. Gefragt sind also Systeme, die effektiv und sicher arbeiten, sich flexibel einsetzen lassen und mit einem geringen Aufwand zu administrieren und zu pflegen sind und so die Gesamtbetriebskosten im grünen Bereich halten.

Wird im Pool mehr Rechenleistung benötigt als insgesamt vorhanden, können einfach zusätzliche Blades hinzugefügt werden.
Als Mittel der Wahl gilt oft das Server-Based-Computing. Das Prinzip dieser Technologie ist dabei ebenso einfach wie bestechend: Alle Anwendungen liegen zentral auf einem Server oder einer Serverfarm und werden dort ausgeführt. Der einzelne Arbeitsplatz-PC dient nur noch zur Darstellung der anzuzeigenden Bildschirminformationen. Die Vorteile dieser Struktur liegen auf der Hand: Alle Mitarbeiter können zu jeder Zeit und von jedem Ort aus auf ihre aktuellen Daten und Programme zugreifen. Da die Daten zentral gespeichert werden, ist auch ihre Sicherheit gewährleistet. Neue Programme und Updates stehen jedem Mitarbeiter gleichzeitig zur Verfügung und die aufwändige Administration der einzelnen Arbeitsplätze entfällt. Und last but not least lassen sich an den Arbeitsplätzen mittelfristig teure Hardware-Ressourcen durch günstigere ersetzen. Doch führt dieser Weg wirklich zu einem dynamischen Rechenzentrum, das die IT-Infrastruktur automatisch wirtschaftlicher und gleichzeitig leistungsfähiger macht?
Ein Blick in die Rechenzentren macht deutlich, dass die Wirklichkeit momentan noch etwas anders aussieht: 80 Prozent der installierten Server werden heute im Schnitt mit einem Auslastungsgrad von nur 20 Prozent und weniger betrieben. Dies hat seinen guten Grund: Die Server sind so ausgelegt, dass sie auch Spitzenlasten abarbeiten können, was zur Folge hat, dass sie in anderen Zeiten völlig überdimensioniert sind, da die Zuordnung von Anwendungen zu Servern statisch gelöst ist und eine Änderung nur mit großem Aufwand erfolgen kann.
Virtualisierte Serverleistung
Das Konzept des Server-Based-Computing kann aber nur durch den Einsatz von Servern aufgehen, mit denen sich die Aufgaben schnell und bedarfsorientiert auf die vorhandenen Ressourcen verteilen lassen. Nur so lassen sich die geforderte hohe Flexibilität und dynamische Anpassungsfähigkeit der IT-Infrastruktur gewährleisten und auch wirkliche Kostenvorteile erzielen. In der Blade-Server-Architektur sind die entscheidenden Grundprinzipien für die Effizienz, Flexibilität und Kontinuität von IT-Infrastrukturen für Unternehmensanwendungen bereits in die Praxis umgesetzt.
Die Frage ist also, wie viel Leistung ein Rechenzentrum tatsächlich benötigt, ohne Engpässe auf Grund dynamischer Marktveränderungen zu riskieren. Und wie sich die Aufgaben so auf die IT verteilen lassen, dass die Ressourcen möglichst gut ausgelastet sind. Die Antwort darauf könnten universelle Serverkonzepte wie die Blade-Technologie geben: Hier wird die Rechenleistung von vielen gleichen und standardisierten Bausteinen – den Blades – zur Verfügung gestellt und kann je nach Bedarf von einer intelligenten Managementsoftware den einzelnen Aufgaben zugewiesen werden. Das heißt, Anwendungen und Ressourcen werden virtualisiert. Dies ist möglich, da es für den praktischen Betrieb irrelevant ist, auf welchen und wie vielen Blade-Servern eine Anwendung abläuft. Die Kapazitäten stehen als virtueller Ressourcenpool zur Verfügung, dessen spezifische Eigenschaft für die Applikation keine Rolle mehr spielt. Mittels virtueller Maschinenkonzepte können beispielsweise auf einem leistungsfähigen Server auch mehrere Betriebssysteme oder Anwendungen gleichzeitig und völlig getrennt voneinander ablaufen. Eine Technik, die bei Großrechnern schon länger eingesetzt wird.
Wird im Pool mehr Rechenleistung benötigt als insgesamt vorhanden, können einfach zusätzliche Blades hinzugefügt werden. Bei diesem sogenannten Scale-Out-Verfahren erhöht sich die Leistung – die Skalierung – also durch Hinzufügen weiterer gleicher Server, anstatt immer größere Server erforderlich zu machen (Scale-up). Die Blades stellen einen gemeinsamen Pool für Rechenleistung dar, der aus nur sieben oder auch aus 7000 Blades bestehen kann. Andere IT-Infrastrukturaufgaben, wie Ein- und Ausgabe oder Speicher, sind in weiteren Pools zusammengefasst, die nach dem gleichen Prinzip verwaltet werden.
Ende der Aufgabenteilung
Durch die Pool-Bildung wird die klassische Aufgabenteilung im Rechenzentrum zwischen Frontend, Application-Layer und Backend aufgehoben, denn anstatt jede Aufgabe an eine bestimmte Maschine starr zu vergeben, können Blades an allen Stellen eingesetzt werden. Beispielsweise eignen sich moderne Blades für den Frontend-Betrieb von Webservern oder Terminalserverfarmen ebenso wie für den Einsatz als SAP-Applikationsserver, den Betrieb von Datenbanken oder als Plattform für Messaging-Systeme. Durch die Möglichkeit, die einzelnen Server-Blades innerhalb eines Systems zu mischen und bei Verfügbarkeit auch neue Blades – etwa mit 64-Bit-Technologie – hinzuzufügen, lässt sich der Pool ständig anpassen und erneuern.
Zu dieser Flexibilität kommt hinzu, dass die Installation neuer Blade-Server wesentlich einfacher und schneller geht als bei herkömmlichen Systemen. In der Regel genügt es, ein neues Blade einzustecken und eine entsprechende Managementsoftware kann innerhalb kürzester Zeit die neue Hardware für den produktiven Einsatz nutzbar machen. Im Praxistest ließ sich beispielsweise ein ganzer Terminalserver-Pool aus 210 BX300-Blades unter »Citrix Metaframe XPe« mit Hilfe der ausgeklügelten Management-Umgebung von Fujitsu Siemens Computers und Visionapp innerhalb von weniger als vier Stunden komplett neu konfigurieren oder installieren – eine Aufgabe, die angesichts der 5000 eingetragenen Benutzer, 700 verschiedenen Applikationen und insgesamt 300 Druckertreibern andernfalls Wochen gekostet hätte. Für den Anwender bedeutet dieser Fortschritt weniger Wartezeiten, geringere Personalkosten und eine deutlich verbesserte Agilität seiner IT-Infrastruktur.
Geringere Komplexität
Nach Aussagen des Gartner-Group-Analysten Andy Butler verbringen etwa drei Viertel aller IT-Mitarbeiter in Rechenzentren ihre Zeit damit, lediglich die bestehende Infrastruktur am Laufen zu halten. Die anderen Aufgaben, wie Neuentwicklungen oder Sicherheitsverbesserungen, kommen also zu kurz. Moderne Blade-Server sind daher so konzipiert, dass sie möglichst wenig Personal für Installation und Betrieb benötigen. Beispielsweise entfällt mit dem Blade-Konzept im Idealfall nahezu der gesamte bisherige Verkabelungsaufwand, wenn alle nötigen Verbindungen beispielsweise für Strom, Netzwerk und Konsolen bereits in den Einbaurahmen, der die Blades aufnimmt, integriert sind. Auch die Netzwerkinfrastruktur zur Kopplung der Blades sollte in den integrierten Switch-Blades enthalten sein. Was bleibt, sind dann nur noch wenige Verbindungen zum Unternehmensnetzwerk, zur Konsole und zur Steckdose. Diese geringere Komplexität steigert auch direkt die Zuverlässigkeit um zirka den Faktor zwei gegenüber klassischen Servern, da deutlich weniger Steckverbindungen und Einzelteile involviert sind. Alle I/O-Pfade sowie die integrierten Management-Blades sind im Chassis redundant ausgelegt und erhöhen damit den Level der Verfügbarkeit.
Durch diese klare, hoch integrierte Struktur lassen sich Blade-Systeme sehr kompakt aufbauen. So passen – je nach Hersteller – bis zu 300 Server in ein einziges Rack mit einem Stellplatzbedarf von weniger als einem Quadratmeter. Damit die Blades trotz solch einer hohen Packungsdichte einen kühlen Kopf bewahren, sollten sie mit entsprechend stromsparenden Prozessoren ausgestattet sein. Das schlägt sich nämlich nicht nur direkt in deutlich niedrigeren Energiekosten nieder, sondern auch in weniger Aufwand für Klimatisierung und die obligatorische unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Ausgefeilte Verwaltungssoftware erforderlich
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Blade-Server ihr Effizienz-Versprechen auch halten können, ist eine hoch entwickelte Verwaltungssoftware. Aufgabe der Managementsuite ist es, dafür zu sorgen, dass der Administrator den gesamten Pool zentral verwalten kann, anstatt alle Konfigurationsdetails manuell überwachen oder ändern zu müssen. Neuartige Softwarelösungen ermöglichen es dem Administrator sogar, Regeln festzulegen, nach denen der Pool sich in einem bestimmten Rahmen selbst verwaltet. Wird beispielsweise für den Monatsabschluss mehr Leistung benötigt, kann das Management automatisch mehr Blades zur Verfügung stellen. Die Verwaltungslogik muss auch in der Lage sein, fehlerhafte Blades oder Prozesse zu erkennen. Damit erhöhen solche Managementlösungen auch die Verfügbarkeit. Zudem stürzen Blades nicht ab, wenn einmal ein Bauteil defekt sein sollte, da sie so ausgelegt sind, dass kein »Single Point of Failure« existiert. Eine generelle Hot-Plug-Fähigkeit ermöglicht auch eine Reparatur oder den Aus- und Einbau von Blades oder Netzteilen und Lüftern im laufenden Betrieb. Neben einer flexiblen Einsatzmöglichkeit, garantieren Blades also auch eine hohe Kontinuität der Geschäftsprozesse.
Das selbe gilt für das Storage-Konzept der Blade-Technologie. Die vorhandenen Kapazitäten sind in einem Speicher-Pool zusammengefasst und werden über standardisierte Schnittstellen wie Ether-net oder Fibre-Channel den Blade-Servern zur Verfügung gestellt. Spiegelung oder Backup und Restore werden innerhalb des Storage-Pools ausgeführt, ohne die Blade-Server damit zu beanspruchen. Den Blade-Servern steht auf diese Weise ein stets verfügbarer, virtualisierter Speicher zur Verfügung.
Da der Speicherbedarf im Unternehmen weiter ungebremst wächst – derzeit im Durchschnitt mit 90 Prozent pro Jahr – muss die Massenspeicherkapazität dem steigenden Bedarf folgen können. Mit entsprechenden NAS- und SAN-Storage-Systemen lässt sich diese Erweiterung im laufenden Betrieb durchführen. Der Vorteil für die Wirtschaftlichkeit: Der vorhandene Speicher kann gut ausgelastet werden. Anstatt große, brach liegende Kapazitäten vorzuhalten, müssen die Unternehmen also nur bei tatsächlichem Bedarf in neue Speicher investieren.
Blades unterstützen das Server-Based-Computing
Blade-Server werden in den Rechenzentren der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Auf Grund ihrer Wirtschaftlichkeit und Flexibilität sind sie eine ideale Plattform für effizientes Server-Based-Computing. Ihr hoher Automatisierungsgrad sorgt beispielsweise dafür, dass so gut wie keine Kosten mehr für Stillstandszeiten anfallen und die Verfügbarkeit der Anwendungen erheblich gesteigert wird. Zudem lassen sich auch die Administrationskosten von Blades gegenüber herkömmlichen Systemen erheblich senken. Mit den entsprechenden Servern sowie einer hoch entwickelten Administrationssoftware lassen sich die Vorteile des Server-Based-Computing auf diese Weise erst richtig ausschöpfen.
Hendrik Leitner, Leiter Marketing & Business Development Solution & Services Deutschland, Fujitsu Siemens Computers