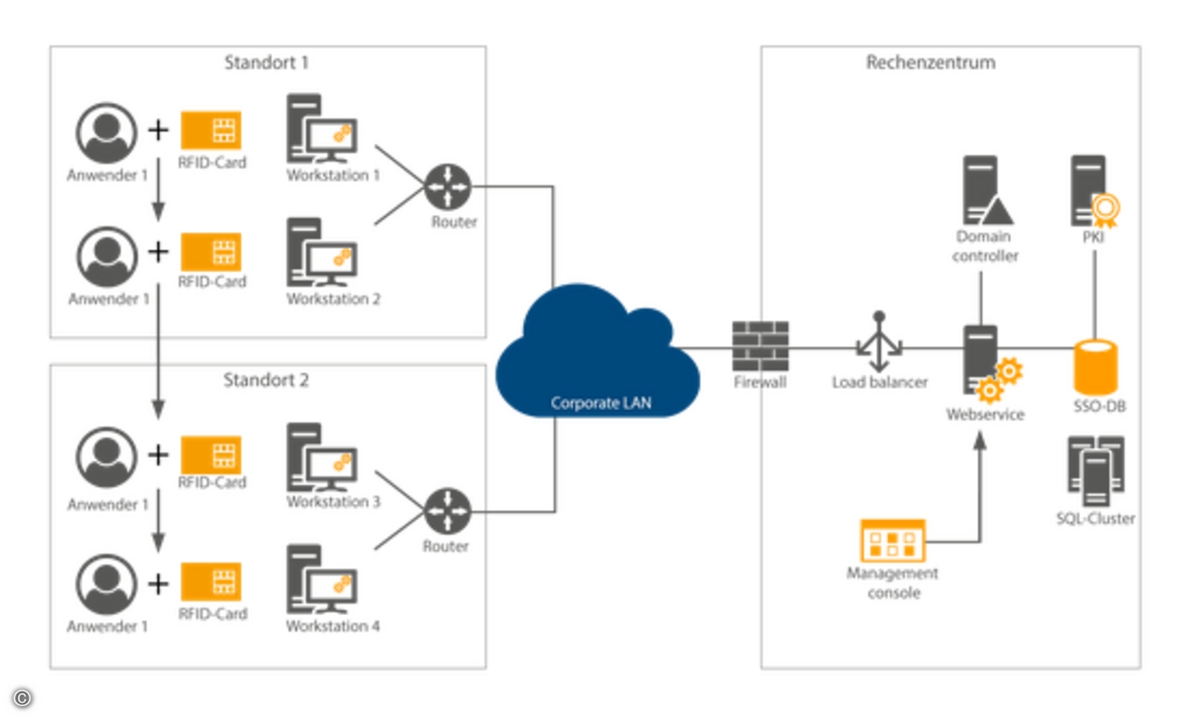RFID-Technologie: Ein Oldie macht Karriere
RFID-Technologie: Ein Oldie macht Karriere. Die RFID-Technologie (RFID = Radio Frequency Identification) ist im Grunde ein alter Hut: Bereits in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden die ersten kommerziellen Vorläufer auf den Markt gebracht. Doch erst jetzt ist die Welt reif für die alles erfassende Datenflut.
RFID-Technologie: Ein Oldie macht Karriere
In den Sixties diente die RFID-Technik als simple, elektronische Warensicherung mit einer »Speicherkapazität« von einem Bit. Ab den 80er Jahren kam RFID auch in der Automobilindustrie zum Einsatz, etwa bei Wegfahrsperren, Tankkarten und funkgesteuerten Türöffnern. Durch die zunehmende Miniaturisierung entstanden immer neue Einsatzgebiete, etwa beim bargeldlosen Zahlungsverkehr oder bei der Personensicherheit.
Chip im Menschen
Die Einsatzmöglichkeiten reichen heute von der Logistik, Warenautomation und Archivierung über Systeme für Zugangskontrollen bis hin zur Tieridentifikation. Im November 2004 machte die amerikanische Gesundheitsbehörde (FDA) den Weg für eine weitere Anwendung frei: Den Einsatz im Menschen. Der »Verichip« der US Firma Applied Digital Solutions wird unter der Haut eingepflanzt. Im Notfall erhalten Ärzte so in Sekundenschnelle wichtige Patienteninformationen wie die Blutgruppe, bestehende Allergien oder Krankheiten.
Moderne Leihbüchereien wie die neue Wiener Hauptbücherei verwenden RFID-Tags bereits zur Bestandskontrolle. Einige RFID-Lesegeräte sind in der Lage, spezielle Tags stapelweise und berührungslos zu lesen. Dieses Leistungsmerkmal bezeichnet man als Pulk-Lesung. Ein bereits weit verbreitetes Einsatzgebiet der RFID-Technik ist der Gebrauch als berührungslose, wieder aufladbare Fahrkarte. In zahlreichen asiatischen Metropolen, unter anderem Hongkong und Singapur, wird sie bereits eingesetzt. Durch die Verwendung von RFID-Technologie lassen sich in einigen Bereichen auch neue gesetzliche Auflagen einfacher erfüllen: Etwa bei der EU-Verordnung 178/2002 (Artikel 18), die seit Jahresbeginn eine globale Rückverfolgung von Lebensmitteln über alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen einfordert.
Insgesamt hat sich die Technologie in den vergangenen Jahren rasant entwickelt, wobei jedoch lange versäumt wurde, Industriestandards zu definieren. Die mangelnde Standardisierung bereitet dem Branchenverband Bitkom nun Sorge: Die künftige Verbreitung von RFID werde unter anderem auch davon abhängen, inwieweit es gelinge, einheitliche Standards für diese Technologie festzulegen. Der Bitkom will den Einzug der RFID-Technologie im Rahmen entsprechender Projekte unterstützen und versteht sich als »Instanz zur Bündelung von Expertenwissen und zum Austausch von Erfahrungen«.
Zahlreiche Hersteller wie Philips, Infineon oder Texas Instruments produzieren derweil RFID-Tag-Varianten für ein breites Einsatzspektrum: In der einfachsten und preisgünstigsten Version enthält der Transponder eine fest kodierte, offen lesbare Kennung, die nicht überschrieben werden kann (»Read Only-Tag«). Sie können sehr kompakt produziert werden und sind wartungsfrei. Die Transponder werden meist samt Antenne auf eine Folie aufgebracht, sind bedruckbar und können fast wie Papier weiterverarbeitet werden. Inzwischen sind zahlreiche, unterschiedliche Arten dieser so genannten Smart Labels verfügbar. Je nach Frequenzbereich bieten sie eine Lese-Reichweite von einem Meter, zwei Meter oder auch bis zu 100 Meter.
Höhere Leistungsfähigkeit und Flexibilität bieten RFID-Tags, die über einen beschreibbaren Speicher verfügen. Die Speichergröße reicht je nach Variante von wenigen Bits bis hin zu einigen hundert Kilobyte. Für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf sind RFID-Tags mit fest eingebauten Verschlüsselungsmechanismen verfügbar. Auch RFID-Tags mit Mikroprozessor und eigenem Betriebssystem sind inzwischen erhältlich. Diese Tags werden meist in der Bauform einer Chipkarte hergestellt (»Dual-Interface-Karten«).
Grundsätzlich wird je nach Art der Energieversorgung zwischen passiver und aktiver RFID unterschieden: Passive RFID-Tags besitzen im Gegensatz zu den aktiven Varianten keine eigene Stromquelle. Letztere sind deutlich größer, weniger robust gegenüber Umweltbedingungen und teurer. Die Einsatzgebiete der passiven Tags sind breit gefächert, ein Schwerpunkt liegt jedoch in der Warenlogistik. Aktive Tags kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo die zusätzlichen Leistungsmöglichkeiten den Nachteil der erforderlichen Stromversorgung und der höheren Kosten kompensieren. So können aktive Tags beispielsweise mit Hilfe integrierter Sensoren zur Temperaturüberwachung oder zur exakten Positionsbestimmung (mittels GPS-Satellitenüberwachung) eingesetzt werden. Ideal etwa bei Feinkost oder besonders teuren Waren.
Barcodes bleiben am Leben
Auch der klassische Barcode hat jedoch noch nicht ausgedient: Barcodes sind ? ebenso wie der zugehörige EAN-Produktcode ? weltweit verbreitet und bislang deutlich kostengünstiger. Allerdings speichern RFID-Tags wesentlich mehr Informationen als der EAN-Code: Jeder einzelne Artikel kann beim RFID-Einsatz mit einer weltweit eindeutigen Seriennummer versehen werden, während mit der bislang verwendeten EAN-Nummer lediglich die Art eines Artikels identifiziert werden kann, nicht jedoch das einzelne Produkt. Electronic Product Code (EPC) soll die Basis für eine weltweit eindeutige Seriennummer bilden, mit der sich Milliarden Stück jedes registrierten Artikels individuell kennzeichnen lassen: Eine 96-Bit-EPC-Implementierung ermöglicht etwa die eindeutige Vergabe von über 68 Milliarden Seriennummern.