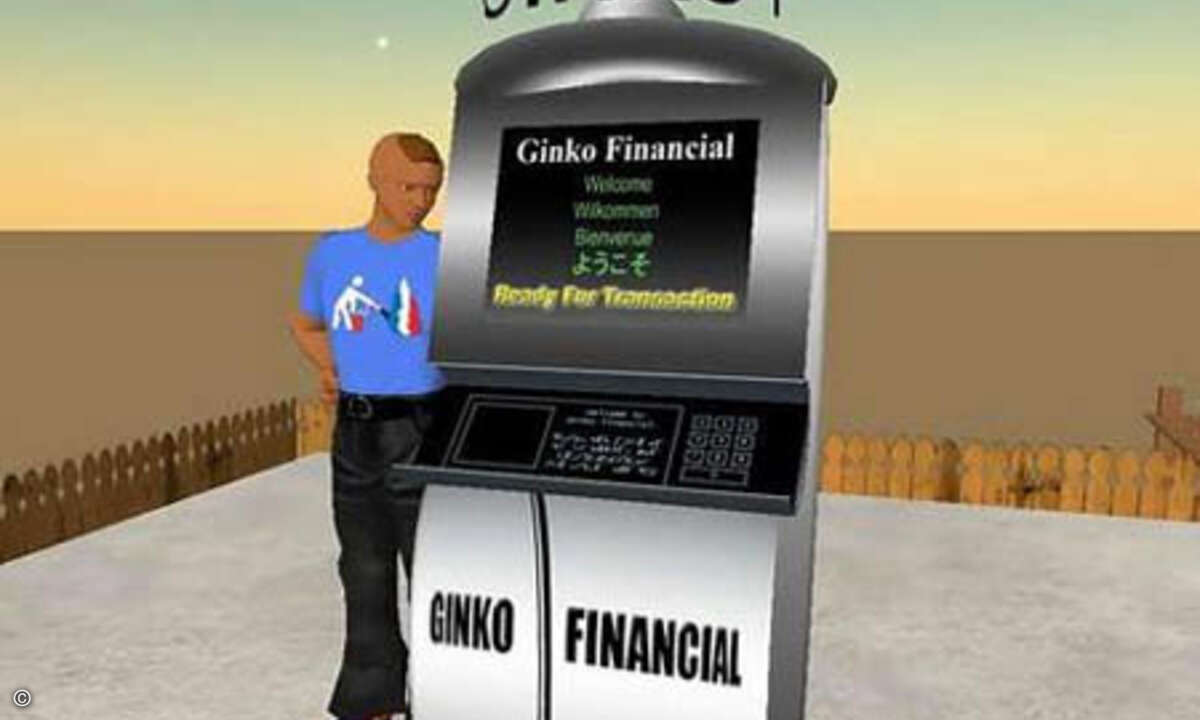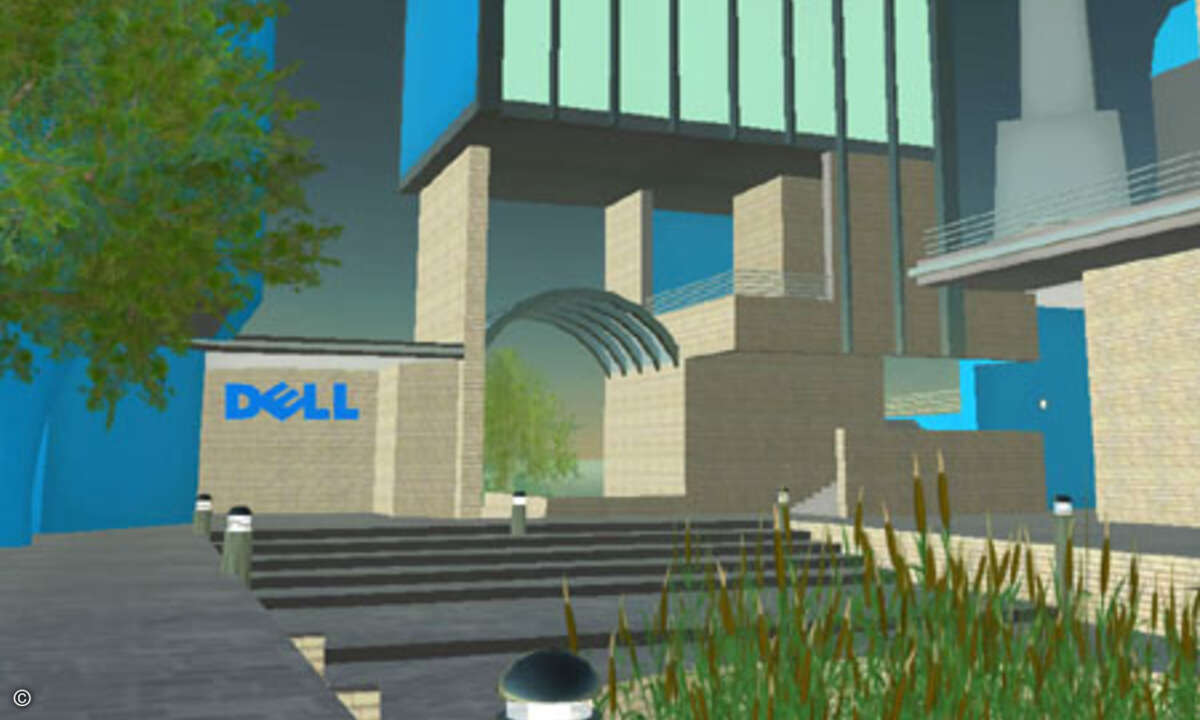Second Life Kein rechtsfreier Raum
Second Life Kein rechtsfreier Raum In virtuellen 3D-Welten gilt das Motto »Alles ist möglich« nur scheinbar. Negativschlagzeilen in Sachen Kinderpornographie und unerlaubtes Glücksspiel lassen aufhorchen. Doch wo ist die rechtliche Grenze und welches Recht gilt für Second Life?
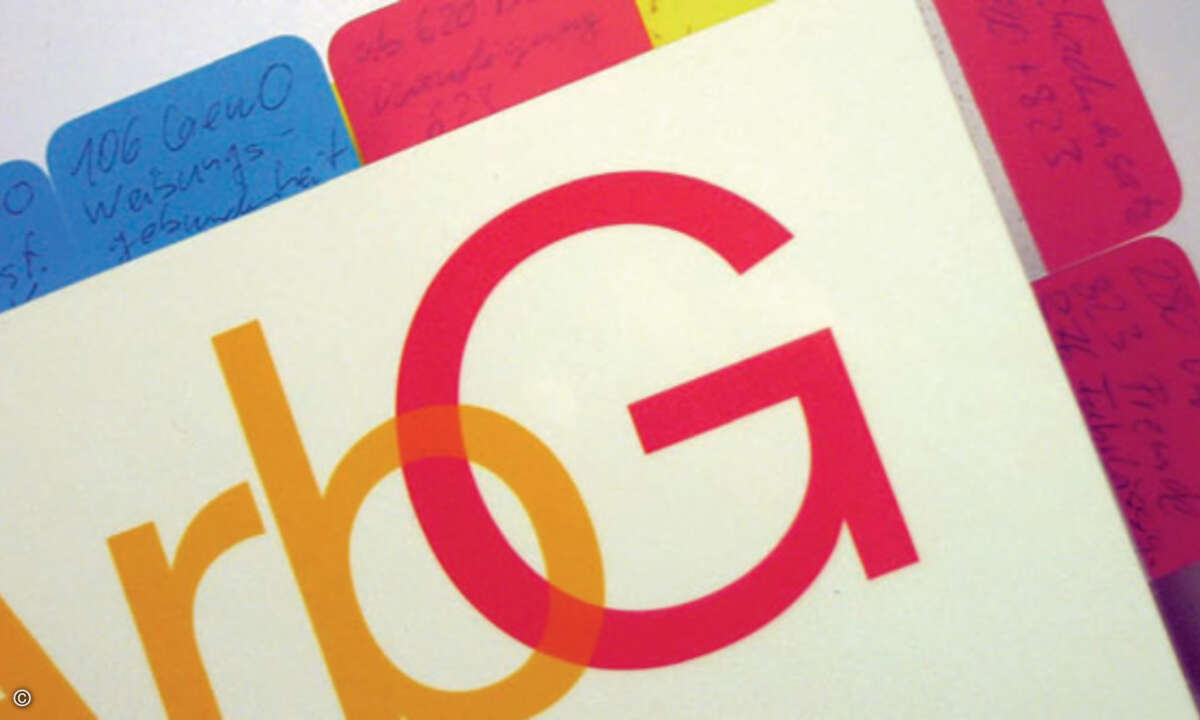
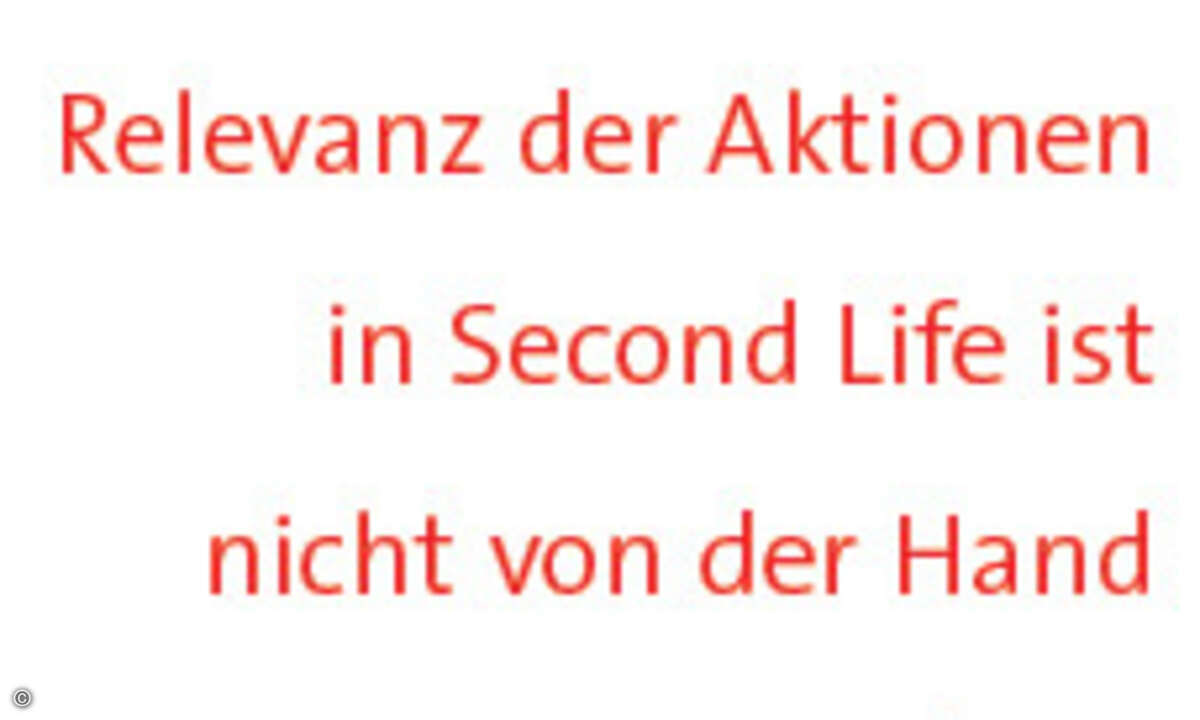
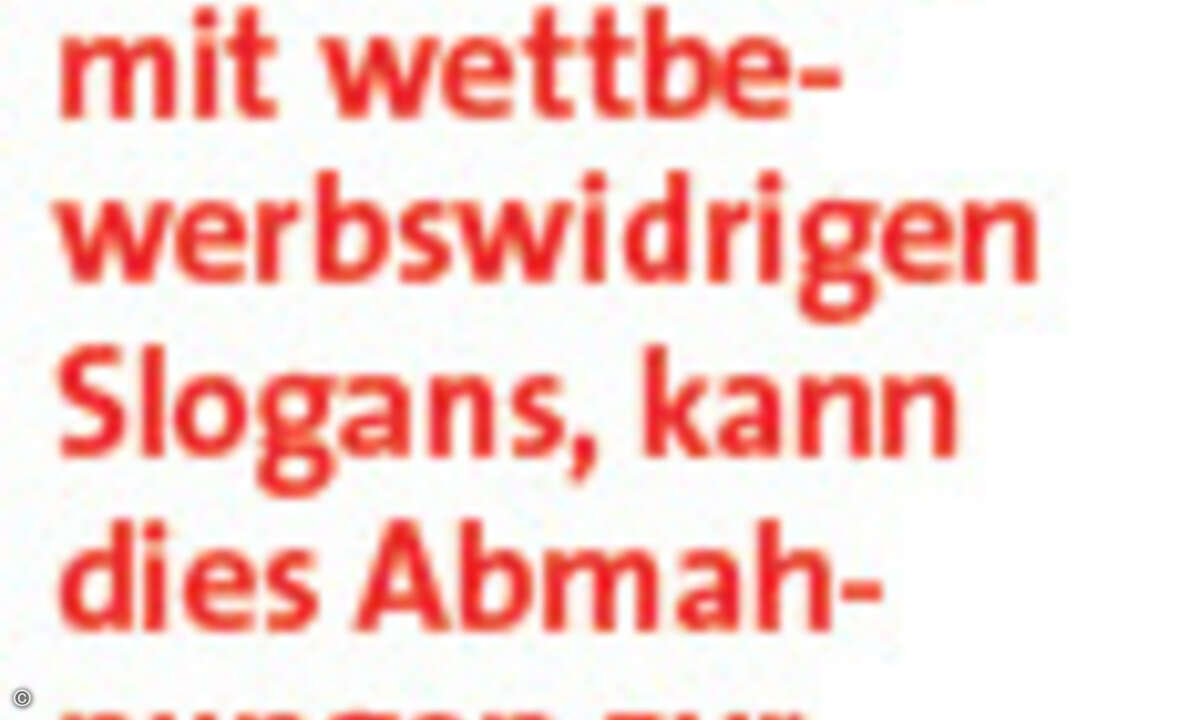
Der verharmlosende Verweis, es sei doch alles nur virtuell, kann und darf die Diskussion darüber, wie relevant das Geschehen beispielsweise in Second Life für die nicht-digitale Welt ist, nicht im Keim ersticken. Second Life ist mehr als virtuell: Linden-Dollar sind in US-Dollar rücktauschbar, Inhalte zwischen den Bewohnern können ausgetauscht, Geschäftstreffen in Second Life abgewickelt werden und auch Geschäftskontakte können entstehen, die in der realen Welt fortgeführt werden. Eine rechtliche Relevanz der Aktionen in Second Life ist damit nicht von der Hand zu weisen. Wie immer ist die Realität den Juristen jedoch voraus: So gibt es zu Second Life bisher noch keine Rechtssprechung in Deutschland. Second Life ist für Teilnehmer aus aller Welt zugänglich. Der Betreiber Linden hat seinen Sitz in San Francisco, der Standort der Server ist nicht bekannt – doch kürzlich wurde angedeutet, dass sich diese nicht in den USA befinden, sondern überall auf der Welt verteilt sind. Die bisherige Kommunikationssprache ist englisch. Bei diesen Fakten erscheint es manchem unvorstellbar, dass überhaupt deutsches Recht Anwendung finden kann.
Für die Einhaltung des Rechtes ist jeder selbst verantwortlich Ein Blick in die Nutzungsbedingungen von Second Life bringt jedenfalls keine Klärung. Diese verweisen auf die UN-Konventionen und das Recht des Staates Kalifornien. Diese einseitige Bestimmung des geltenden Rechts ist gegenüber deutschen Verbrauchern – dies werden wohl die meisten Nutzer aus Deutschland sein – unwirksam, zumindest, was die Regelungen des Verbraucherschutzes anbelangt. Für Straftatbestände spielt eine solche Bestimmung sowieso keine Rolle. Zum lokalen Recht gibt es innerhalb der Nutzungsbedingungen nur den lapidaren Hinweis, dass jeder für die Einhaltung des ihn betreffenden Rechts selbst verantwortlich ist.
Server-Standort ist irrelevant Wie beim Internet ist es für die Geltung deutschen Rechts irrelevant, ob sich der Server des Angebots außerhalb Deutschlands befindet oder ob die Betreiberfirma aus den USA stammt. Dies schafft in der Praxis sicherlich Vollstreckungs- und Ermittlungshürden, ändert aber nichts an der Rechtslage. Der Anwendungsbereich für deutsches Recht besteht, soweit Teilnehmer aus Deutschland in Second Life agieren oder die Maßnahmen und Aktionen einen Bezug zum deutschen Rechtsraum haben.
Bisheriges Recht unzureichend Sobald die deutsche Version von Second Life online geht, wird dies allein schon aufgrund der eindeutigen Sprachzuordnung leichter feststellbar sein als bei der englischen Version. Aber auch bei der englischen Version gibt es bereits Bereiche, wie zum Beispiel das »Apfelland«, das sich selbst als Deutschland in Second Life bezeichnet und speziell deutsche Inhalte und auch Werbung von Firmen enthält. Hier ist der Deutschlandbezug von vornherein indiziert. Das bisherige Recht wird für eine Regelung der Vorfälle in Second Life für unzureichend erachtet. Dabei gibt es Möglichkeiten, tätig zu werden, falls bei Second Life Handlungsbedarf gesehen wird. Da Second Life auch für deutsche Internetnutzer zugänglich ist, steht es zum Beispiel der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) frei, sich über die Möglichkeiten und Darstellungen innerhalb dieses »Telemediendienstes« zu informieren und es bei Bedarf zu kennzeichnen oder gar zu indizieren. In Deutschland tätige Unternehmen, die auf Second Life agieren, oder auch Internetfilterprogramme für Minderjährige, müssten eine Kennzeichnung berücksichtigen. Die Schwierigkeit besteht also nicht darin, dass es mit Second Life einen rechtsfreien Raum gibt. Vielmehr führt die Internationalität des Angebots zu Schwierigkeiten, das Recht auch tatsächlich zu vollstrecken und durchzusetzen.
Haftungsrisiken der Unternehmen Auch für in Second Life präsente Unternehmen ist nicht »alles möglich«. Die meisten Unternehmen nutzen Second Life bisher als reine Darstellungs- und Werbeplattform. Wirbt zum Beispiel ein Unternehmen mit wettbewerbswidrigen Slogans, kann dies Abmahnungen zur Folge haben. Zudem ist es Unternehmen beispielsweise auch nicht erlaubt, mit geschützten Marken zu werben oder diese zu verunglimpfen. Werbungen, die sich allein auf dem virtuellen Umfeld von Second Life bewegen, zum Beispiel das Angebot, eine Kaffeemaschine kostenlos zu erhalten, fehlt es an der wettbewerbsrechtlichen Relevanz. Sie sind daher kaum rechtlich verfolgbar. Ein Realitätsbezug ist demgegenüber insbesondere bei solcher Art von Werbung gegeben, die auf die Webseite verlinkt, wo das beworbene Produkt gekauft werden kann. Eine Haftung der Unternehmen ist weiterhin möglich, wenn es in den Geschäftsräumen des Unternehmens oder in ihrer Machtsphäre zu Rechtsverstößen kommt. Wird ein Second Life-Bewohner beispielsweise in einem Shop durch einen Unternehmensmitarbeiter beleidigt, kann es wie bei einem Chat keine Rolle spielen, ob der Second Life-Bewohner unter seinem richtigen oder unter der Second Life-Identität in Erscheinung getreten ist. Nach derzeitigem Recht ist hierfür aber stets eine Auswirkung auch auf die reale Welt erforderlich, was allein schon durch einen geldwerten Schaden wegen des möglichen Tauschs von Linden-Dollar in US-Dollar der Fall sein kann.
Überwachung der Mitarbeiter Neben dem gewollten Werbeeffekt und der Fokussierung auf die junge Zielgruppe ist eine Präsenz bei Second Life für Unternehmen daher auch eine Verantwortung hinsichtlich Pflege und Überwachung der in Second Life tätigen Mitarbeiter und eingestellten Inhalte. Philip Rosendale, der Gründer von Linden LAB, meinte kürzlich in einem Interview, dass sich die Bewohner im Idealfall als SL-Bewohner und nicht wie Bewohner ihres Landes verstehen sollten. Das Recht des eigenen Landes sollte dabei jedoch nicht in Vergessenheit geraten. Denn rechtlichen Maßnahmen kann nicht durch »Beamen« mittels »Teleport« entgangen werden.
Dr. Karolin Nelles, Rechtsanwältin der Kanzlei Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl, München