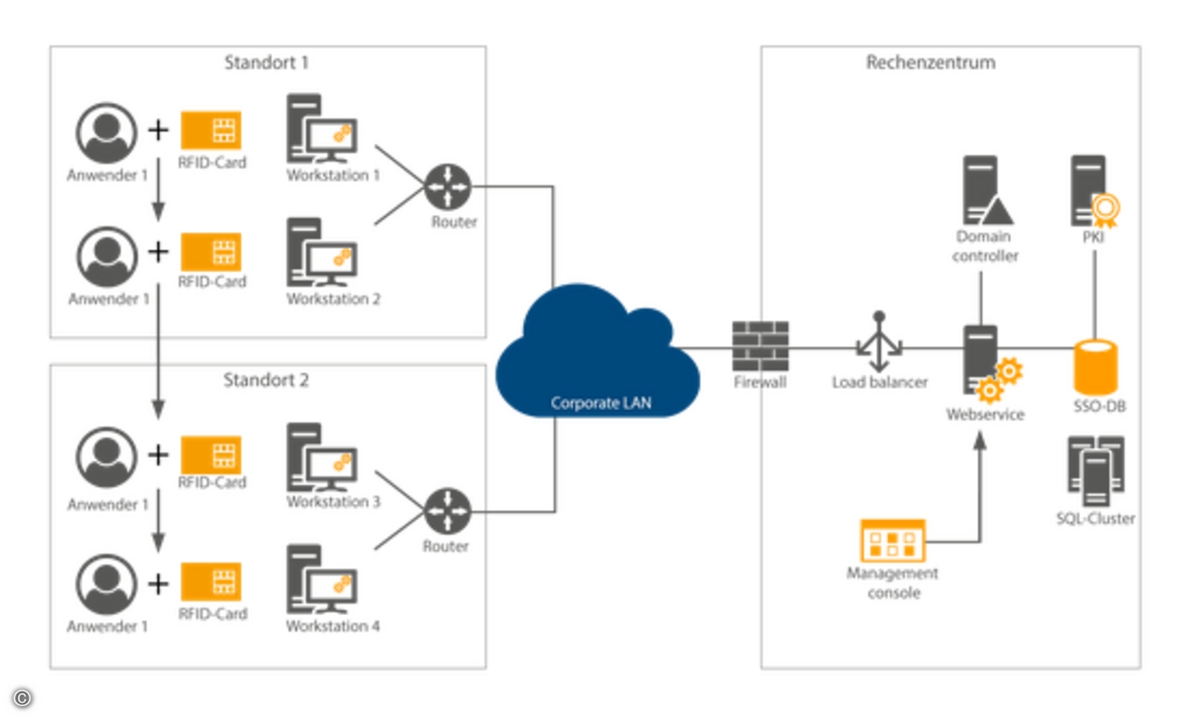Wer Aufzug fährt, zahlt
Bei Strom und Gas ist es selbstverständlich, bei Müll (noch) nicht: Abrechnungen nach dem Verursacherprinzip. Die RFID-Technologie kann heute schon Kosten individuell zuordnen, die bisher nach dem Gieskannenprinzip verteilt werden. Nebenbei bemerkt: Das wird unser Verhalten in Zukunft gehörig verändern. Schaden muss das nicht.
- Wer Aufzug fährt, zahlt
- Viel Müll - hohe Kosten
Politisch hat sich der Sozialismus überlebt, ökonomisch betrachtet, lebt das Gemeinschaftsprinzip munter weiter. Zum Beispiel beim privaten Müllaufkommen. Ein Hausbesitzer, so sieht es kommunales Recht vor, hat eine Mülltonne zu haben und für diese zahlen, auch wenn er für sich reklamiert, gar keinen Müll zu verursachen. Der Mieter einer Erdgeschosswohnung zahlt, wie der Mieter im achten Stockwerk, anteilig die Wartungskosten für Aufzüge. Solche kollektiven Umlagen sind keine Frage der Gerechtigkeit, sondern schlich und ergreifend Resultat eines bisher unmöglich erscheinenden Verrechnungsmodus: Wer Kosten verursacht, soll dafür auch aufkommen. Kosten nach individuellem Verbrauch, Gebrauch oder Aufkommen aufzuschlüsseln, sie gemäß dem Verursacherprinzip in Rechnung zu stellen: Neue Technologien werden diesem Ansatz zum Durchbruch verhelfen.
Pay as you drive
Beispiel KFZ-Versicherung: Wer nur wenig fährt, sein Auto meist an verkehrsarmen Tagen nutzt und überdies auf Straßen verkehrt, die in der Unfallstatistik kaum negativ in Erscheinung treten, könnte künftig bei der Prämie kräftig sparen. Zumindest dieses Argument führen einige Versicherungen ins Feld, wenn es darum geht, mit Hilfe modernster Satelliten- und IT-Technik das tatsächliche Fahrverhalten ihrer Klientel kontrollieren zu wollen. Wer riskant fährt - zum Beispiel junge Fahrer bis 21 Jahre, die zwischen 23 und 6 Uhr unterwegs sind - soll mehr zahlen. Andere, die etwa sichere Autobahnen nutzen und Landstraßen mit hoher Unfallgefahr meiden, zahlen weniger.
Solche Daten ermittelt eine On-Board-Unit, eine kleine Box, die ähnlich wie bei LKWs auch im privaten KFZ eingebaut ist und permanent GPS-Navigationsdaten über das GSM-Netz an Rechenzentralen von IT-Dienstleistern sendet, die solche Daten individuell aufbereiten und sie den Versicherungsgesellschaften melden. Ein Zukunftsszenario aus Forschungslaboratorien? Keinesfalls. Ein solches System ist bereits in Großbritannien installiert, auf dessen Basis die Norwich Union, das größte Versicherungsunternehmen auf der Insel, bereits seit Anfang 2005 den Tarif »Pay as you drive« anbietet und mit einem Kostenvorteil bis zu 30 Prozent wirbt. Dabei erhalten die Kunden eine Rechnung, in der ihre persönliche Autoversicherung nach Kilometern, Straßen und Tageszeit pro Monat abgerechnet wird.
»Wir können die Versicherungsprämie erstmals nach der wirklichen Nutzung des Autos berechnen«, jubelt auch Johannes Hajek, Vorstandssprecher des österreichischen Versicherers Uniqa. Innovativ, zukunftsträchtig und ein perfektes Geschäftsmodell für die Zukunft, unterstreicht Axel Preiss, Leiter IBM Business Consulting, das lupenreine »Business on Demand«-Pilotprojekt. Auch T-Systems preist das praktisch gleiche Modell als Innovation an. Ausgerechnet eine Genossenschaft, die ursprünglich für den öffentlichen Dienst gegründet wurde, erweist sich hier als Vorreiter für eine ITK-Pionierlösung: Die Württembergische Gemeinde-Versicherung WGV aus Stuttgart, eine von Städten und Kommunen gegründete Versicherung. »Risikoarmes Fahren wird belohnt«, gibt WGV-Vorstand Klaus Hackbarth den Trend für die hart umkämpfte Branche der KFZ-Versicherer vor. Aber das soll noch nicht alles sein: Die Prämieneinsparungen sollen Autofahrer disziplinieren und so die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, ist der Versicherungsmann überzeugt. Ein wenig überzeugendes Argument, denn noch nicht einmal hohe Benzinpreise sorgen dafür, dass der Geldbeutel über den Unverstand mancher Autofahrer siegt.