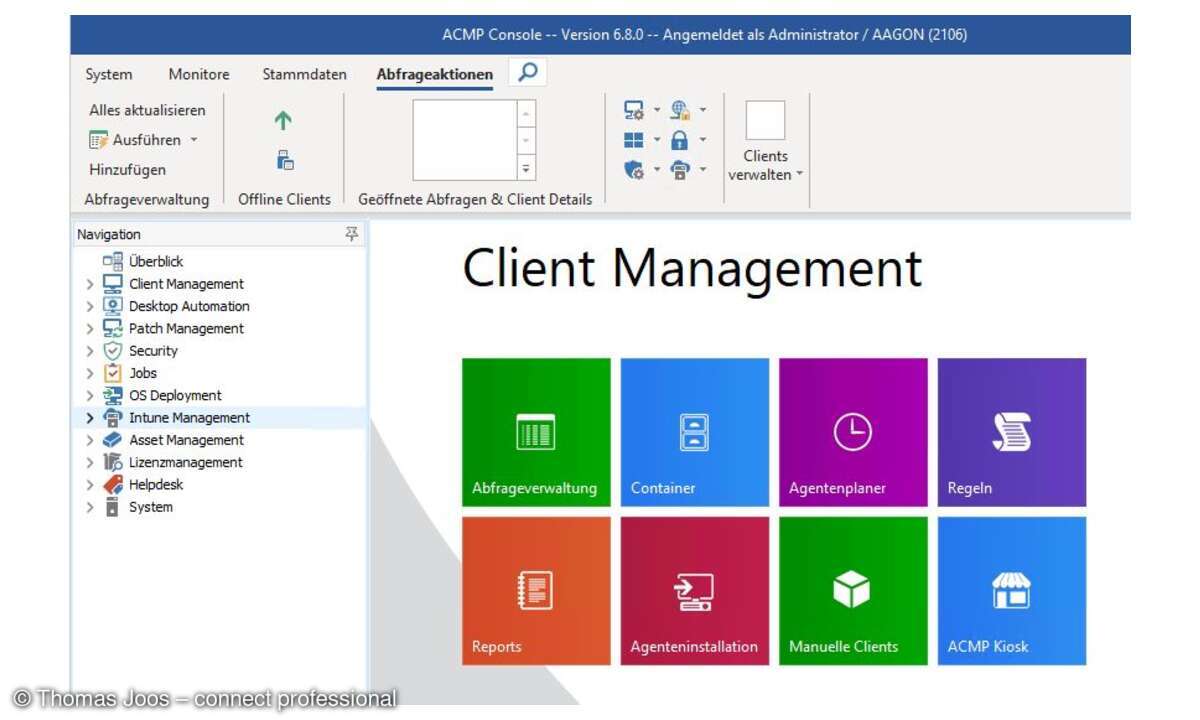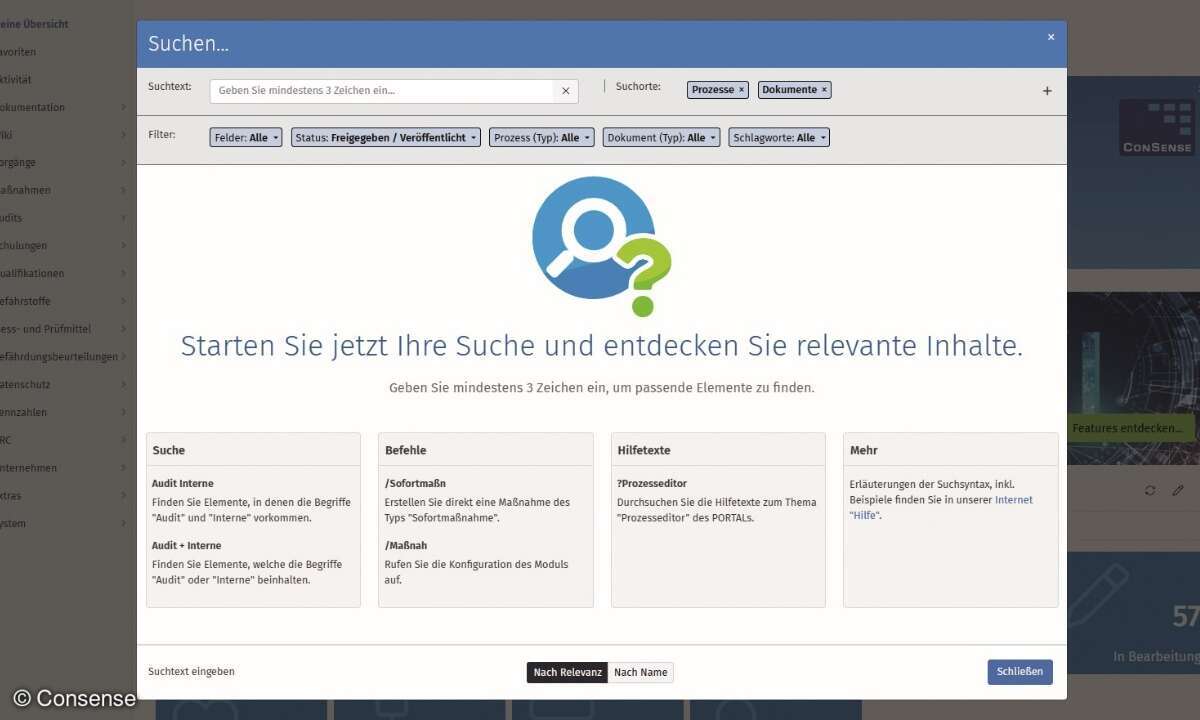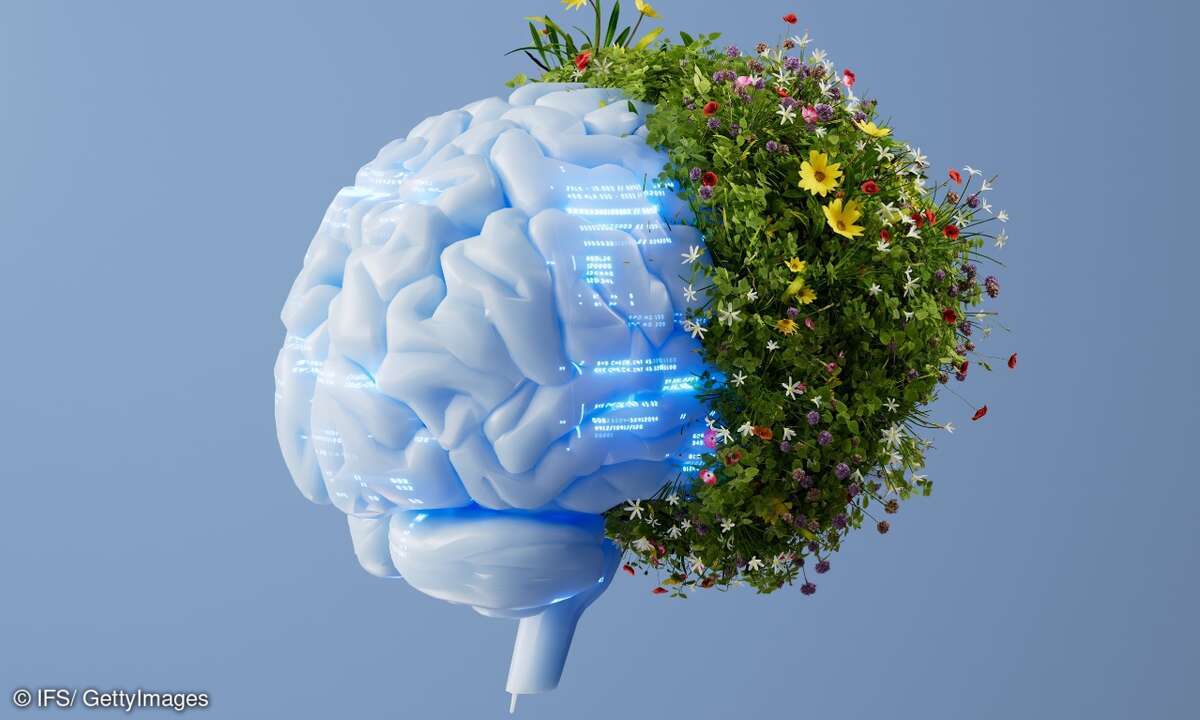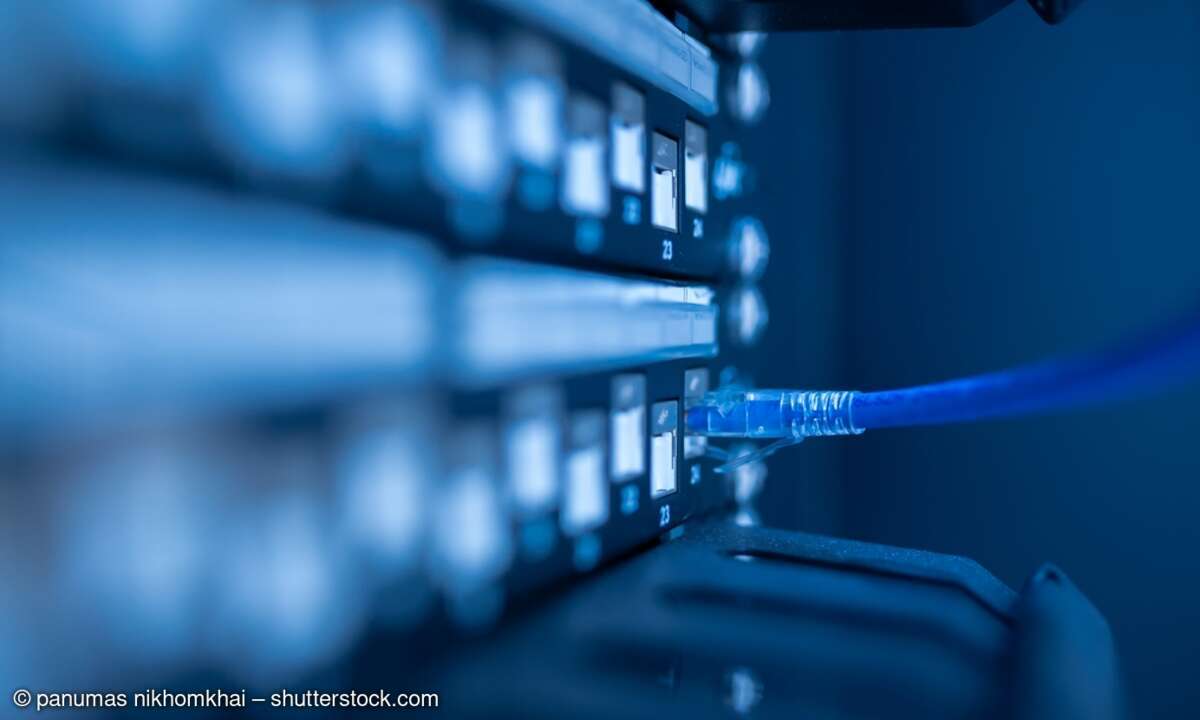Erfolgsfaktoren für BSM
Business-Service-Management (BSM) ist ein ganzheitliches strategisches Konzept, um die IT aus einer Geschäftsperspektive zu steuern. Bei der Umsetzung sind die Verantwortlichen mit komplexen Rahmenparametern konfrontiert, zum Beispiel mit unterschiedlichen Management-Systemen, heterogenen Kundenanforderungen, einer geerbten IT-Infrastruktur oder einer Fülle zu verwaltender Systeme. Auch der "Faktor Mensch" darf nicht vernachlässigt werden.
Business-Service-Management ist in ITILv3 (IT Infrastructure Library Version 3) definiert als "
the ongoing practice of governing, monitoring, and reporting on IT and the business service it
impacts" (die laufende Ausübung der Steuerung, Überwachung und des Reportings von IT und des
Geschäfts-Services, den sie beeinflusst). Damit geht die im Mai 2007 veröffentlichte Version
deutlich über die Best Practices von ITILv2 hinaus, die die operativen
IT-Service-Management-Prozesse beschreiben und damit in der IT-Welt verhaftet bleiben.
BSM-Wegbereiter ITIL
Der Perspektivwechsel hin zu einem Monitoring aus der Geschäftsprozesssicht ist das
wesentlich Neue, das ITILv3 über das so genannte "Service-Lifecycle-Management" adressiert. Die
Autoren des Rahmenwerks rücken damit die Phasen im Lebenszyklus eines Services in den Mittelpunkt.
Ein IT-Service wird nun als Vermögenswert (Asset) betrachtet. Dabei unterscheidet ITIL die
Nützlichkeit eines Services (Utility) von der erforderlichen Qualität und Zuverlässigkeit
(Warranty). Erst die Kombination beider Aspekte bringt den erforderlichen Mehrwert.
Die Trennung der Prozesse nach einzelnen Funktionen war in der praktischen Umsetzung nicht
immer hilfreich, da die Wechselwirkungen unterschiedlicher Themen zu wenig Berücksichtigung fanden.
Doch der integrative Ansatz entlang einzelner Prozesse bietet nun einen ganzheitlichen Blick und
überwindet vorhandene Silo-strukturen – zumindest theoretisch. Denn die Praxis in den Unternehmen
hält derzeit noch nicht Schritt: Zwar hat ein Großteil der Firmen inzwischen das Prozess-Framework
von ITILv2 zumindest punktuell umgesetzt, aber die Durchdringung von ITILv3 verläuft schleppend.
Erst gut 20 Prozent beschäftigen sich derzeit mit diesem Thema.
CMDB als Wissenszentrum für BSM
Im Mittelpunkt aller BSM-Initiativen steht in der Regel eine Strategie für das
Konfiguratons-Management mit dem Ziel, Informationsinseln zusammenzuführen und alle benötigten
Service-Strukturen und -Komponenten in einer oder mehreren CMDBs (Configuration Management
Database) abzubilden. Da es in der Regel verschiedene Datenpools gibt, zum Beispiel für die
Netzinfrastruktur, die Server-Landschaft oder SAN (Storage Aerea Network), ist es ein pragmatischer
Ansatz, mit einem CMDB-Metadatenmodell zu arbeiten. Dieses kann auch eine proprietäre CMDB
enthalten. Eine BSM-Lösung sollte in einem Federated-CMDB-Ansatz vielfache Quellen zusammenfassen
und übergreifende Beziehungen darstellen können.
Neben den Daten zu IT-Komponenten und ihren Verbindungen birgt die CMDB idealerweise das
komplette Know-how der IT, also auch Erfahrungsberichte, Skills, Verträge, Known Errors, Dokumente
zum Anwenderverhalten etc. Allerdings sollten Verantwortliche nur so viel CMDB planen, wie für ihr
BSM-Projekt auch nötig ist. Andernfalls besteht die Gefahr, sich in Details zu verlieren, die ohne
großen Aufwand nicht mehr zu bewältigen sind. Denn Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz ist
eine hohe Aktualität und Vollständigkeit der Daten.
Konzentriert man sich auf eine erste Teilaufgabe, kann das Erfassen von IT-Services und
-Komponenten zunächst in einem überschaubaren Bereich, also zum Beispiel für einen bestimmten
Kunden, einen Standort oder auch hardwarebezogen erfolgen. In der Praxis hat es sich jedoch
bewährt, zunächst einen ausgewählten Geschäftsprozess abzubilden und nach einer Analyse alle
hierfür relevanten Services wie Server, Netzwerke, Leitungen und Endgeräte in ihren
Wechselwirkungen zu erfassen. Alle Informationen, die diesen Service direkt beschreiben und bei
einem Ausfall Auswirkungen auf den Betrieb haben, werden so dokumentiert. Der Geschäftsprozess
sollte auch eine gewisse Außenwirkung haben, sodass die IT Quick Wins vermarkten kann.
Eine CMDB allein bringt keinen Mehrwert, beeinflusst aber durch ihre Querschnittsfunktion
alle anderen BSM-Themen. Sie ist die Grundlage aller Service-Management-Prozesse und wird aus
diesen auch gepflegt. Erst mit der Unterstützung durch integrierte Prozesse wie beispielsweise
Change, Release- oder Software-Asset-Management (Lizenz-Management) entsteht auf der Basis
aktueller Daten die notwendige Effizienz und Effektivität.
Automatisches Dependency Mapping
Oft beinhaltet eine CMDB über 100.000 Configuration Items, manchmal ein Mehrfaches davon. Die
Komplexität der IT-Infrastruktur in größeren Unternehmen hat stark zugenommen, ebenso die
Häufigkeit von Change Incidents. Dies stellt hohe Anforderungen an die Qualität und Aktualität der
Daten. Eingelesene technische Informationen allein bringen in der Praxis keinen Mehrwert. Mit einer
gut gepflegten CMDB hingegen lassen sich Schwachstellen einer Komponente und ihre Auswirkungen auf
betroffene Anwendungen, Geschäftsprozesse und Kunden darstellen. Verantwortliche können damit
antizipieren, welche Risiken zum Beispiel eine geplante Konfigurationsänderung birgt.
Eine manuelle Pflege solcher Datenvolumina ist nicht sinnvoll realisierbar. Allein für das
Update einer bereits gefüllten CMDB inklusive dynamisch angepasster Verknüpfungen sind
erfahrungsgemäß 250 bis 500 Stunden zu veranschlagen. Werkzeuge für Automatic Dependency Mapping
benötigen dafür nur wenige Minuten und verkürzen so den Aufwand für die Datenpflege um bis zu 99
Prozent.
Die Überführung der Daten in die CMDB erfolgt dabei durch einen dedizierten Pflegeprozess. Ab
einer kritischen Datenmenge lassen sich Lücken innerhalb der CMDB nur durch eine automatische
Lieferung von Echtzeitdaten schließen, um die End-to-End-(E2E-)Darstellung der Zusammenhänge von
den einzelnen Komponente über die Anwendungen bis zum Geschäftsprozess umzusetzen.
Eine lückenlose Überwachung geschäftskritischer Prozesse hinsichtlich Verfügbarkeit,
Antwortzeiten etc. umfasst zunächst das Monitoring sämtlicher technischen Komponenten aus Sicht der
IT. Typische Metriken und Key Performance Indicators (KPIs) sind zum Beispiel:
systemspezifische Informationen wie CPU-Auslastung, Speicherbelegung etc.,
prozessspezifische Informationen wie zum Beispiel Prozessverfügbarkeit sowie
applikationsspezifische Informationen wie Antwortzeiten, Durchsatz etc.
Verantwortliche müssen allerdings nicht nur Segment- oder Server-Auslastungen, Rahmengrößen
oder Ping-Antwortzeiten kennen, sondern auch die Situation des Nutzers berücksichtigen. Die
Überwachung dieser Zusammenhänge wird als E2E-Monitoring im Sinne des Anwenders verstanden. Denn
zwischen dem zur Verfügung gestellten Service und der Kundenerfahrung bei dessen Nutzung liegt oft
ein weiter Weg.
Anwender haben in der Praxis oft mit Problemen zu kämpfen, selbst wenn die Informationen über
das Systemverhalten und den Ressourcenverbrauch keine kritische Situation erkennen lassen. Zum
Beispiel ist der angeforderte Online-Dienst nicht sofort verfügbar, eine Ressource kann nicht
gefunden werden, ein Download dauert extrem lange oder bricht ab. Bei Applikationen, die im
Outsourcing betrieben werden, ist es sowohl für den Betreiber als auch für den Auftraggeber sehr
wichtig zu verifizieren, ob die in SLAs (Service Level Agreements) vereinbarten Betriebs- und
Antwortzeiten eingehalten werden. E2E-Monitoring ist vor allem für IT-Provider ein unverzichtbares
Werkzeug zur laufenden Überwachung und Analyse der Qualität bereitgestellter Services.
Überwachung der Service-Kette
Dies erfordert, für die komplette Service-Kette vom Server bis zur Kundenapplikation
Messpunkte, Schwellenwerte und Eskalationsbeschrei-bungen zu definieren, an denen sich die
vereinbarten SLAs orientieren. Standardisierte Messmethoden gewährleisten dabei die
Wiederholbarkeit von Messungen zu gleichen Bedingungen, um realistische Aussagen zu
Qualitätsverbesserungen treffen zu können. Die Unterstützung der eingesetzten Werkzeuge zur raschen
Lokalisierung eines Problems verlangt Funktionen wie beispielsweise Root Cause Analysis
(Fehlerermittlung), Impact Analysis (Auswirkungsanalyse) oder Drill-down. Letzteres erlaubt dem
Administrator den direkten Durchgriff vom betroffenen Business-Service über Teiltransaktionen bis
hin zu einzelnen Komponenten.
Um IT-Services bedarfsgerecht und effizient zu erbringen, bedarf es einer systematischen
Strukturierung des IT-Leistungsangebotes. Aufbau und Pflege eines standardisierten Service-Katalogs
gestalten sich allerdings in der Praxis sehr schwierig. Entscheidend ist, dass die Services
gemeinsam mit dem Kunden und aus Kundensicht beschrieben sind. Vor allem für die Nutzer ist der
IT-Service-Katalog ein ideales Instrument.
Die Umformung der oft über 300 verschiedenen technischen Leistungsarten in Geschäftsprodukte
ist der komplexeste Schritt. Es gilt, eine Vielzahl von Ressourcen und Leistungen zu
berücksichtigen und über eine Maßeinheit, beispielsweise einen Standard-Office-Arbeitsplatz, zu
verrechnen. Die Beschreibung eines entsprechenden IT-Services enthält differenziert die enthaltenen
Leistungen, die Verrechnungseinheit und den Preis pro Einheit, technische Voraussetzungen (zum
Beispiel bestimmte Hardware) und Bedingungen (zum Beispiel Mindestlaufzeiten) oder auch explizit
den Ausschluss bestimmter Leistungen. Typische Leistungsgegenstände für SLAs sind Themen wie
Systemverfügbarkeit, Reaktionszeiten, Ausfallsicherheit oder das Vorhalten von Server-Ressourcen.
So kostet ein Premium-Arbeitsplatz mit einem größeren Bildschirm, mehr Rechnerkapazitäten,
einem zusätzlichen Softwarepaket zur Bildbearbeitung und einer 724 Hotline schnell das Mehrfache
eines Standardarbeitsplatzes. Kostentransparenz und Verständlichkeit mittels eines
IT-Servicekatalogs sind die Voraussetzung für die Akzeptanz einer kundenorientierten,
verursachergerechten Leistungsverrechnung sowie effektiven Planung.
Angesichts der Komplexität des Themas lässt sich ein BSM-Modell praktisch nur in
Einzelschritten umsetzen, die allerdings in eine Gesamtstrategie eingebettet sein müssen.
Unternehmen benötigen viele Zwischenetappen. Das Analystenhaus Forrester rechnet mit mindestens
vier Jahren. Aber der Weg ist das Ziel, und das Ziel lohnt.
Dr. Thomas Gerick ist verantwortlich für die Unternehmenskommunikation bei USU in
Möglingen.