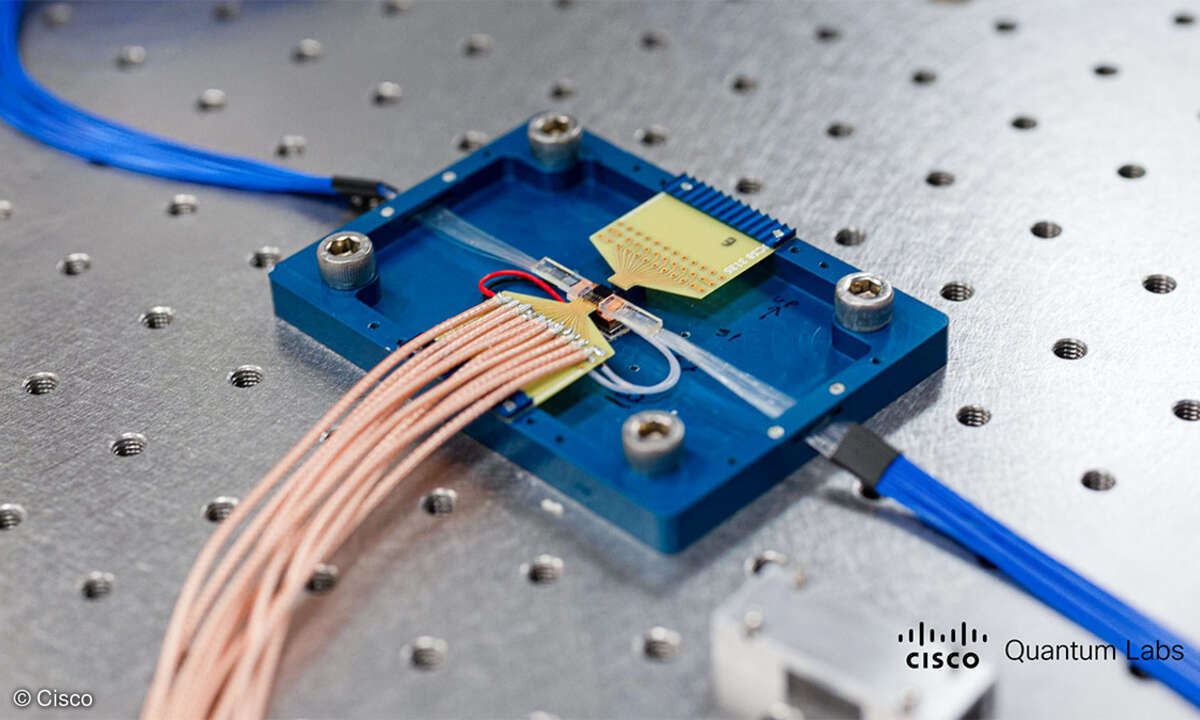Von der Arbeit auf Zuruf zum CLM-Prozess
Spezialisierte Lösungen für das Client-Lifecycle- und das IT-Service-Management (CLM, ITSM) gehören in vielen Unternehmen bereits zu den Grundvoraussetzungen für den reibungslosen IT-Betrieb. Bislang standen diese Systeme aber unverwandt nebeneinander, obwohl die Vorteile einer Integration der benachbarten Techniken auf der Hand liegen. Nun kündigt sich der nächste Entwicklungsschritt an: die Verbindung von CLM und ITSM zum konsolidierten IT-Infrastructure-Management.
Die Zielsetzungen des Helpdesks oder – in der aktuellen Ausprägung – des Service-Desks sind
klar: An erster Stelle stehen die Steigerung der Kundenzufriedenheit und eine beschleunigte
Problemlösung. Hier verspricht die Integration von CLM und ITSM zukünftig Vorteile bei der
Einführung eines geordneten Change- und Release-Managements. Hersteller aus beiden Lagern haben
diesen Trend erkannt und suchen nach Partnern mit komplementären Angeboten oder akquirieren
entsprechendes Know-how.
Wie sinnvoll und werthaltig die entstehenden Lösungen für die Unternehmen sind, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Schon bei der grundlegenden Aufgabe – der Bereitstellung von
Informationen des PC-Lifeycle-Managements für den Service-Desk – zeigen sich erhebliche
Unterschiede in der Integrationsfähigkeit. Noch größer sind die Differenzen bei der Auslösung von
CLM-Prozessen durch den Service-Desk – eine der zentralen Anforderungen des
IT-Infrastructure-Managements.
Integration von Informationsbeständen
Helpdesk-Systeme beschränken sich heute meist noch auf das reine Incident-Management. Selbst
technisch ausgereifte Systeme mit Prozessmodellierung konzentrieren sich im Kern auf die
Aufgabenverwaltung. Bei allen auftretenden Fragen muss der Helpdesk-Mitarbeiter das System
wechseln, um die benötigten Informationen zu erhalten. Hersteller von ITSM-Lösungen haben auf
dieses Problem mit Such- und Inventarisierungsfunktionen (Discovery, Inventory) reagiert – nur
stammen diese Daten eben aus dem ITSM und nicht aus dem CLM, sodass wesentliche Aspekte nicht
erfasst werden. Oft ist beispielsweise nicht erkennbar, ob Probleme nur mit Systemen auftreten, auf
die das Lifecycle-Management vorher eine bestimmte Applikation aufgespielt hat. Ebenso fehlen
versionsgenaue Angaben über den eingesetzten Softwarebestand.
Parametrierter Aufruf der CLM-Konsole
Die einfachste Möglichkeit, dem Service-Desk diese Informationen zu liefern, besteht in einem
parametrierten Aufruf der CLM-Konsole, wie ihn die meisten ITSM-Systeme unterstützen. Bei dieser
Minimallösung navigiert der IT-Mitarbeiter zumindest gleich zum betroffenen Desktop – eine kleine
Erleichterung, aber weit entfernt von effizienter Informationsbereitstellung. Zudem führt dies zu
einem Berechtigungsproblem: Der Helpdesk erhält die komplette CLM-Konsole inklusive aller
Funktionen. Am anderen Ende der Komplexitätsskala steht das Dependency Mapping über eine CMDB
(Configuration Management Database), in der alle Service Trees abgebildet sind. Die modernsten
Systeme können so eine Analyse von Fehlerursachen (Root Cause Analysis) durchführen und zum
Beispiel angeben, ob eine Störung des E-Mail-Empfangs ihre Ursache in einem vollen Postfach, einem
ausgefallenen Router etc. hat. Der Nachteil: Der Aufwand für eine komplette Kartographierung der
IT-Landschaft ist immens hoch und rechnet sich bislang sogar im Enterprise-Umfeld nur mit
Einschränkungen.
Der pragmatische Ansatz besteht demnach in einer informationsseitigen Verbindung des
Service-Desks mit dem Lifecycle-Management. Auf diesem Weg werden qualitativ bessere Daten und vor
allem auch Change-Historien verfügbar. Die meisten ITSM-Lösungen ermöglichen den Datenimport aus
dem CLM und synchronisieren den Bestand bei jedem Importvorgang. Damit sind die Daten aber nur
bedingt aktuell. Besser ist hingegen die Verbindung über Konnektoren, die eine Betrachtung der
Daten in Echtzeit ermöglichen. Moderne Dienste verwenden dementsprechend keinen DB View, sondern
nutzen das Netzwerkprotokoll SOAP (Simple Object Access Protocol) und fragen über Webservices die
Daten live ab.
Der Detailierungsgrad der Informationen hängt dabei vollständig von der CLM-Lösung ab: Als
besonders vorteilhaft erweist sich hier ein Policy-basierter Managementansatz, da sich auf diesem
Wege Systeme sofort identifizieren lassen, die nicht dem definierten Zustand entsprechen
(Non-Compliance, Desired-State-Management). Das Lifecycle-Management erkennt also Probleme und
erstellt Trouble-Tickets, wodurch der Service-Desk zum Beispiel bei einer definierten Anzahl
gleicher Tickets selbsttätig Eskalationsprozesse starten kann. Zudem ermöglichen manche
CLM-Lösungen das Auslesen der Fehlerinformationen des Windows Installers, sodass Problemquellen
schneller auffindbar sind.
Service-Desk muss Prozesse anstoßen können
Eine drastische Steigerung der Rate für die umgehende Fehlerbehebung (First Call Resolution)
lässt sich aber nur erzielen, wenn der Service- oder Helpdesk nicht nur über die Informationen aus
dem Lifecycle-Management verfügt, sondern auch entsprechende Prozesse selbst anstoßen kann. In
vielen Unternehmen wird der Helpdesk zunächst versuchen, ein Problem per Remote-Aufschaltung zu
beheben. Hat er hier keinen Erfolg, muss er dem CLM mitteilen, was zu reparieren ist. Dies
erfordert eine vollständige Übersicht aller durchgeführten Aktionen, die im Bedarfsfall einfach
wiederholt werden. Sollte auch dies keinen Erfolg zeigen, löst der Helpdesk eine Neuinstallation
des kompletten PCs aus.
Ob und wieweit sich diese umfassende Integration von CLM und ITSM herstellen lässt, hängt
wiederum wesentlich von der Lifecycle-Managementlösung ab. Entscheidend ist hier der
Automationsgrad: Wenn sich der Build-Prozess inklusive Installation von Treibern, Patches,
Individual- und Standardsoftware nicht lückenlos automatisieren lässt, verhindert dies den
Prozessanstoß durch den Helpdesk. Dann bleibt nur die Orchestrierung von Systemen und Mitarbeitern
über selbstgebaute Task-Listen und Workflows. Auch hier lassen sich durchaus Optimierungspotenziale
verwirklichen. Aufgrund des Entwicklungsvorlaufs erreicht man eine Rentabilität im Vergleich zu
automatisierten System aber später.
Außerdem muss das CLM über anprogrammierbare Schnittstellen verfügen. Eine Notlösung stellt das
direkte Schreiben von Kommandos in die Datenbank dar. Idealerweise hält das CLM hingegen
Webservices für die häufigsten Geschäftsszenarien bereit, so zum Beispiel die Webservices "
Reinstall Computer" (Neuinstallation), "Create Policy" (Softwarezuweisung) oder "Get Software"
(Softwarekatalog holen). Diese Webservices sorgen nach dem Aufruf durch den Helpdesk dann
selbstständig dafür, dass alle Informationen in der Datenbank landen und alle notwendigen Prozesse
in der Infrastruktur gestartet werden.
Unterstützung von Standards wie SOAP und WMI
Hinsichtlich ihres ITSM-Systems müssen Unternehmen darauf achten, dass das System nicht nur das
Schreiben in Datenbanken, sondern auch Standards wie SOAP und WMI (Windows Management
Instrumentation) unterstützt. Damit haben aber einige Lösungen immer noch Probleme. WMI ist
erforderlich, weil es die bevorzugte Methode zur Interaktion mit Microsoft-Managementtechniken
darstellt, über SOAP lässt sich der "Rest der Welt" integrieren.
Ausblick: Applikationen vom Service-Desk aus zuweisen
Unternehmen, die über ein automatisiertes Lifecycle-Management verfügen, eröffnen sich weitere
Möglichkeiten: So liegt es nahe, die Zuweisung von Applikationen in den Service-Desk zu verlagern
und so die Administration weiter zu entlasten. Im ITSM wird hierfür ein Servicekatalog hinterlegt,
in dem die für den Service-Desk verfügbaren Anwendungen und Konfigurationen definiert sind. Für den
Administrator bedeutet dies ein verändertes Aufgabenprofil, da er nicht mehr unmittelbar von den
Anforderungen eines Helpdesks getrieben wird. Stattdessen wandelt sich die IT-Administration dann
zu einer "Entwicklungsabteilung für den Desktop", die entsprechende Automationsbausteine erarbeitet
und zum Abruf durch den Service-Desk bereitstellt.
Ab einem bestimmten Prozessreifegrad stellt sich die Frage: Wie ist das Change- und
Release-Management integrierbar? Ein Kerngedanke der Best-Practice-Sammlung ITIL (IT Infrastructure
Library) ist der kontrollierte Ablauf von Veränderungen (Changes) und die durchgehende
Dokumentation aller durchgeführten Aktionen in der CMDB.
Das PC-Lifecycle-Management stellte hier bislang oft eine Art Schwarzes Loch dar, da es in
kurzer Zeit durchaus gravierende Änderungen auf einer großen Anzahl von Systemen herbeiführen kann.
Die Nutzung von Automationsbausteinen im vollintegrierten IT-Infrastructure-Management verspricht
allerdings eine Lösung: Die Freischaltung von CLM-Aktionen erfolgt über das ITSM, alle Änderungen
durchlaufen definierte Freigabeprozesse (Change Advisory Board etc.) und sind somit lückenlos in
der CMDB und dem ITSM-System dokumentiert.