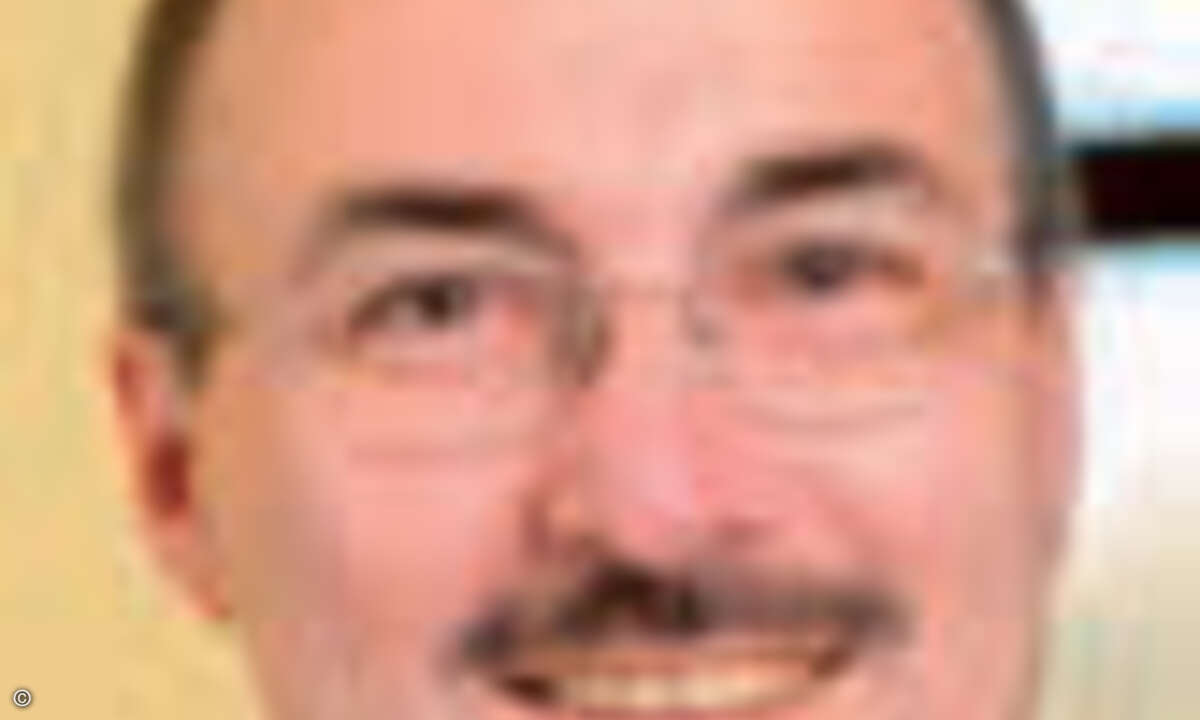Die Macht der Klingen
Blade-Server versprechen eine ganze Reihe von Vorteilen. Wer messerscharf seinen Serverbetrieb kalkulieren will, setzt in vielen Fällen am besten auf die »Server-Klingen«.
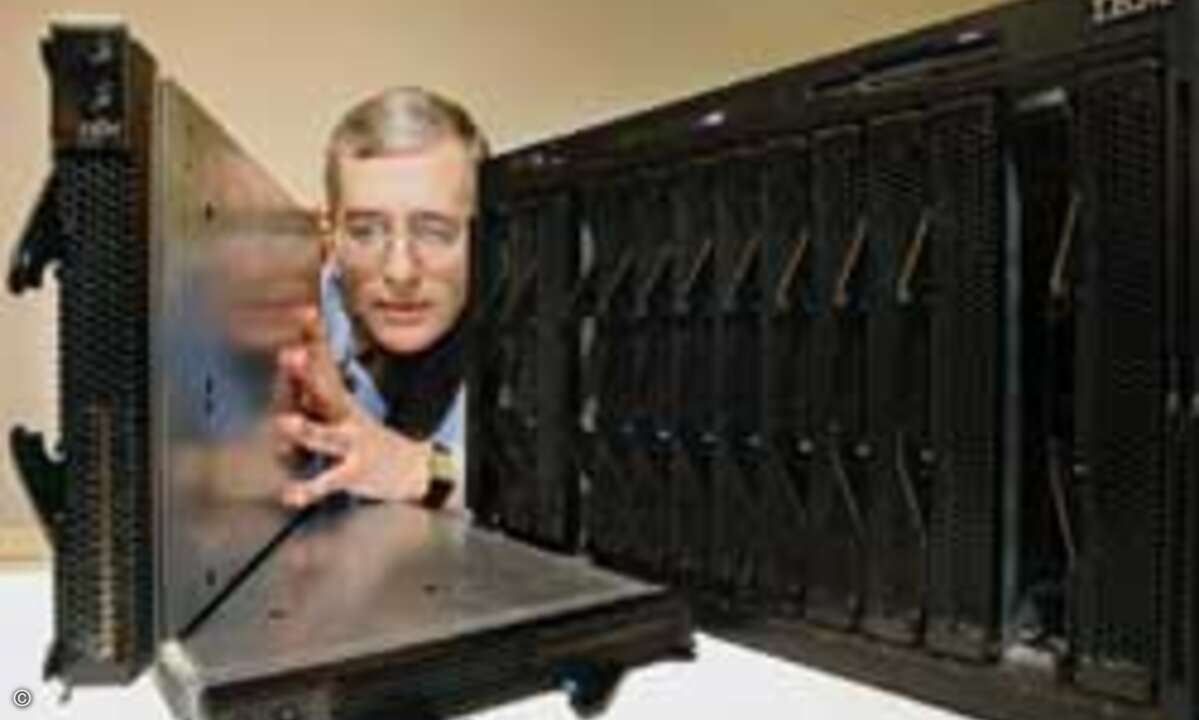
Es bleibt abzuwarten, wie und ob sich die Blade-Technologie zukünftig auch im Client-Umfeld etablieren kann.
Blade-Servern gehört die Zukunft. Zu diesem Schluss kommt zu mindestens das Analystenhaus Gartner. Einer aktuellen Studie zur Folge werden in fünf Jahren rund 16 Prozent aller weltweit ausgelieferten Server Blade-Server sein und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate soll bis 2009 auf 30,6 Prozent klettern. Solche Steigerungsraten sind angesichts der Vorteile von Blade-Server nicht überraschend. Rechenzentren setzen sich heutzutage oftmals aus mehreren tausend Rack-basierten Servern zusammen. Doch bereits die Installation weniger Servern bringt eine hohe Komplexität des Gesamtsystems mit sich. So können Verkabelung, Konfiguration, Aufrüstung und Wartungsaufgaben schnell aus dem Ruder laufen. Ist die Konfiguration darüber hinaus auf Hochverfügbarkeit ausgelegt, steigt – auf Grund der notwendigen Redundanz – die Anforderung an die Verwaltung und Steuerung nochmals. Blade-Server-Strukturen bieten hingegen viel Rechenleistung auf kleinstem Raum bei vereinfachter Verwaltung. Blade-Server ähneln im Gegensatz zu Rack-optimierten Servern, den sogenannten »Pizza-Boxen«, Büchern im Regal: Buchrücken an Buchrücken stehen die eigenständigen Server in einem Chassis. Jedes Blade verfügt über Prozessor, Hauptspeicher, Speicherplatten, Netzwerkcontroller und Betriebssystem. Im Chassis sind sie über eine Backplane mit der gemeinsamen Stromversorgung, dem Lüfter, USB-Geräten sowie Switches und Ports des Netzwerks verbunden.
Durch die geringen Abmessungen der Blades erzielt diese Technologie einen hohen Grad an Dichte. Das »IBM eServer BladeCenter« bietet zum Beispiel in einem industriellen Standard-Rack Platz für sechs Chassis, in denen bis zu 84 Zwei-Wege oder 42 Vier-Wege-Blades installierbar sind. Rechencluster oder Server-Farmen kommen somit mit weniger Komponenten und einer geringeren Anzahl von Racks wie vergleichbare »normale« Server-Anordnungen aus und auch die Verkabelung wird deutlich reduziert. Zudem können Blades leicht zu horizontal wachsenden Clustern zusammengefügt werden und die modulare Skalierbarkeit ermöglicht – entsprechend dem Bedarf – einen über die Zeit verteilten Kapitaleinsatz.
So lassen sich Blade-Strukturen leicht erweitern, da die einzelnen Blades im laufenden Betrieb konfiguriert werden können und durch die einheitliche Struktur im Chassis müssen bei der Installation meistens keine Kabel mehr gesteckt werden. Steigende Server-Anforderungen eines wachsenden Unternehmens lassen sich ohne viel Aufwand erfüllen, indem nur ein weiteres Blade »gesteckt« wird und so dem Netzwerk ein neuer Server zugefügt wird. Darüber hinaus können Blade-Server als Ersatz- oder redundante Server für andere Server entweder im gleichen Chassis oder in einem separaten Chassis konfiguriert werden.
Zur Überwachung und Steuerung der einzelnen Blade-Server verfügt jedes Chassis über ein Management-Element mit Browser-Schnittstelle. Auf diese lokale Funktionalität kann auch außerhalb des Chassis über Standardschnittstellen zugegriffen werden, so dass die zentrale Steuerung von großen Mengen an Blade-Servern über eine gemeinsame grafische Konsole möglich ist. Im Reparaturfall sind die fehlerhaften Komponenten im laufenden Betrieb austauschbar, was für Hochverfügbarkeitsanwendungen von großer Wichtigkeit ist. Darüber hinaus installieren Blade-Server automatisch die gewünschten Betriebssysteme und Anwendungen, ohne dass ein manueller Eingriff notwendig ist.
Dazu dienen Blade-Management-Lösungen wie der »IBM Director«. Die Client-Server-gestützte Plattform überwacht die Server und setzt neue Knoten auf. Das heißt mit Hilfe von benutzerdefinierten Regeln erledigt das System Aufgaben wie das Aufspielen eines ausgefallenen Knotens auf einen Ersatzknoten selbstständig. Ebenfalls Bestandteil der Lösung ist ein Hardwaremodul, das den Zustand der Blade-Komponenten anhand kritischer Kenngrößen wie CPU-Temperatur oder Lüftergeschwindigkeit kontrolliert.
Zudem hilft die Management-Software bei der Prognose bevorstehender Server-Engpässe und gibt proaktive Warnmeldungen an den Administrator zur Automatisierung von Korrekturmaßnahmen und zur Reduzierung von Ausfallzeiten. Darüber hinaus warnt das System vor anstehenden Software-Fehlfunktionen, die zu teuren Standzeiten führen können, und aktualisiert die Software automatisch, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Das Managementmodul wird über eine eigene Web-Oberfläche bedient, wobei jeder Rechner auch direkt über das Internet angesteuert werden kann.
Ähnlich wie bei konventionellen Server-Farmen unterstützt die Technologie von IBM einen heterogenen Mix von Blades, der unterschiedliche Prozessortypen und Leistungsstufen im selben Chassis vereint. Unter verschiedenen Betriebsystemen besteht die Auswahl zwischen einer 32-Bit-Intel- oder einer 64-Bit-IBM-Power-PC-Architektur: Dual-Prozessoren finden idealerweise ihren Einsatz bei Cluster-Anwendungen, während 4-Wege-Blades bei der Transaktionsverarbeitung und Datenbanken ihre Stärken zeigen. Insbesondere im rechenintensiven Bereich des High-Performance-Computing, wie Bioinformatik, Computersimulation oder digitale Signalverarbeitung, bietet die 64-Bit-Technologie attraktive Lösungen. Blade-Server lassen sich somit auf Grund ihrer Eigenschaften sowohl für horizontal skalierende als auch für heterogene Anwendungen einsetzen.
Rechner-Farmen gehört die Zukunft
Die einfache Installation, Integration, Steuerung und Wartung von Blade-Servern ermöglicht ein hohes Maß an Effizienz, Flexibilität und Kostenreduzierung. Im Zusammenspiel mit neuen Technologien, wie Grid-Computing, Autonomic-Computing oder Web-Services lassen sich mit Blade-Servern ausgezeichnet Server-Farmen aufbauen und neue IT-Architekturen wie IBMs »On-Demand«, HPs »Adaptive Enterprise« oder Suns »N1« umsetzen.
Die Hitze im Griff
Lange Zeit kämpften die Hersteller bei der Entwicklung der Blade-Server gegen die Hitzeproblematik: Die hohe Leistung auf engem Raum sorgt für viel Abwärme, die wiederum sehr viel Energie zur Kühlung erfordert. Entwicklungen, wie das Calibrated-Vectored-Cooling-System von IBM, das auf einer besonderen Gehäusearchitektur und Kühlungssystem beruht, lösen dieses Problem. Dabei wird der Luftstrom zur Kühlung des Systems durch äußerst Energie-effiziente Lüfter so durch das System geleitet, dass die Luft von der Vorder- auf die Rückseite des Systems befördern wird und gleichzeitig aktiv alle Komponenten im Inneren des Servers geschützt werden.
So können erstens – ohne das Risiko einer Überhitzung – mehr Komponenten im System untergebracht werden; zweitens kann die Zahl der Lüfter reduziert werden. Das spart sehr viel Strom und reduziert wiederum die Hitzeentstehung. So braucht ein vollständig belegter Blade-Server zwei Lüfter. Das vergleichbare System aus 14 1U-Servern benötigt pro Server acht Lüfter, das heißt insgesamt 112 Lüfter, die alle Strom fressen und Hitze abgeben.
Blades werden bürofähig
Neben der Weiterentwicklung der Blade-Server und Komponenten bleibt abzuwarten, wie und ob sich die Blade-Technologie zukünftig auch im Client-Umfeld etablieren kann. So bietet beispielsweise der Anbieter Clearcube seine PC-Blade-Systeme jetzt auch auf dem deutschen Markt an. Die Lösung besteht aus komplett ausgestatteten PCs in Form von Blades – schlanken Scheiben, die statt am Arbeitsplatz zu stehen, vertikal nebeneinander in das Chassis im Rechnerraum gesteckt werden. Bis zu 112 Blades passen in einen 42 Höheneinheiten hohen 19-Zoll-Schrank.
Die Clearcube-Blades sind wahlweise mit Pentium-4- mit 3,4 GHz oder Dual-Xeon-Prozessoren ausgestattet und entsprechen mit 2 GByte Hauptspeicher, »NVIDIA«-Grafikkarte und einer Festplatte mit 100 GByte oder mehr einem voll ausgestatteten Standard-PC. Der einzelne Benutzer benötigt nur noch einen so genannten User-Port, der etwa so groß ist wie eine Videokassette und unter dem Schreibtisch oder am Monitor befestigt wird. Der User-Port enthält die Anschlüsse für Bildschirm, Tastatur, Maus und weitere Peripherie und verbindet diese mit dem Blade-PC im Rechnerraum. Anwender haben die Wahl zwischen einem C-Port, der eine direkte Verbindung von bis zu 200 Meter über CAT5-Kabel herstellt, und einem I-Port für die Verbindung über Ethernet.
HP hat seit diesem Jahr – allerdings bislang nur für den US-Markt – ebenfalls Blade-PCs im Angebot. Das Konzept von HP besteht aus drei Ebenen: Auf dem Schreibtisch steht ein Thin-Client mit Transmeta-Crusoe-Prozessor. Dieser Thin-Client ist über das Local-Area-Network mit einem Blade-PC (zweite Ebene) verbunden. Dabei lassen sich bis zu 280 Blade-PCs in einem Rack zusammenfassen. Als dritte Ebene des Konzeptes sieht HP zentrale Speicher- und Backup-Systeme sowie Server- und Druckdienste für die virtuellen Arbeitsplatzrechner vor. Die Konzepte sollen den Verwaltungsaufwand für PC-Umgebungen in Unternehmen senken. Zudem sparen die Blade-PCs Platz und ersetzen die Wärme und Lärm erzeugenden Rechner am Schreibtisch. Sie können damit für bessere Arbeitsbedingungen speziell in engen Räumen wie Call-Centern, Handelsplätzen und Schalter-Bereichen sorgen. Außerdem sind sie sowohl für besonders staubige, als auch für besonders reine Umgebungen wie Produktionshallen oder Praxisräume geeignet.
Mit Hilfe der Verwaltungssoftware kann der IT-Administrator das gesamte Blade-PC-System ferngesteuert verwalten. Die Software umfasst je nach Hersteller unter anderem Tools für die automatische Überwachung der Blades, für die Übertragung von Hardware-Images und für das Umschalten zwischen den einzelnen Blades. So kann beispielsweise beim Ausfall eines Blade-PCs automatisch auf ein Reserve-Blade umgeschaltet werden. Die Verfügbarkeit der Clearcube-Umgebung liegt damit beispielsweise laut Hersteller bei 99,9 Prozent Betriebszeit. Und da die Anwender keinen direkten Zugang zu CPU, Festplatte und Datenspeicher haben, bietet die Lösung eine sehr hohe Sicherheit für sensible Daten.
Standards kommen langsam aber sicher
Der Einzug der Blade-PCs in die Büros kann möglicherweise zur schnelleren Einführung von Standards im Blade-Umfeld beitragen. Bislang verfolgte jeder Hersteller sein eigenes Blade-Server-Konzept, ohne dass man sich dabei – oft zum Ärger der Kunden – auf Standards einigen konnte. Einzig allein die Rack-Breite von 19 Zoll gilt als Anhaltspunkt, während schon die Höhe der Blade-Gehäuse selbst innerhalb einer Marke variieren kann. Nicht allein der Boom der Blade-Server, sondern auch die Forderung der Kunden nach Kompatibilität der einzelnen Formfaktoren haben dazu geführt, dass immer mehr Hersteller auf die Festlegung von Standards drängen. So haben beispielsweise IBM und Intel im September 2004 ihre Design-Spezifikationen für Switches, Adapterkarten, Appliance- und Kommunikations-Blades für die IBM-E-Server-Bladecenter-Plattform teilweise offengelegt. Entwickler und IBM-Business-Partner können seither eine kostenfreie Lizenz für die Design-Spezifikationen der IBM-Bladecenter-Server erhalten.
Bislang arbeiten bereits über 100 Unternehmen mit diesen Bladecenter-Spezifikation. Zu den Unternehmen, die die Standards nutzen, gehört unter anderem Emulex, die damit Fibre-Channel-Host-Bus-Adapter für hochleistungsfähige SAN-Verbindungen für IBM-Bladecenter entwickeln. Ranch Networks arbeitet an einem Network-Control-Option-Blade für Anbieter von IP-Telefonie und Tarari integriert ihre Hochgeschwindigkeits-Content-Prozessors eng mit dem Bladecenter-System, um eine äußerst schnelle Plattform für die Verarbeitung von XML und Web-Services zu erhalten.
Konzepte wie diese lassen hoffen, dass die Einführung von industrieweiten Standards für Blade-Server nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, wobei aber sichergestellt sein muss, dass die Standards nicht um der Standardisierung willen eingeführt werden und Kompromisse eingegangen werden, die den Kunden nicht zum Vorteil gereichen. Simone Schreer, IBM PCD Communication / Media Relations