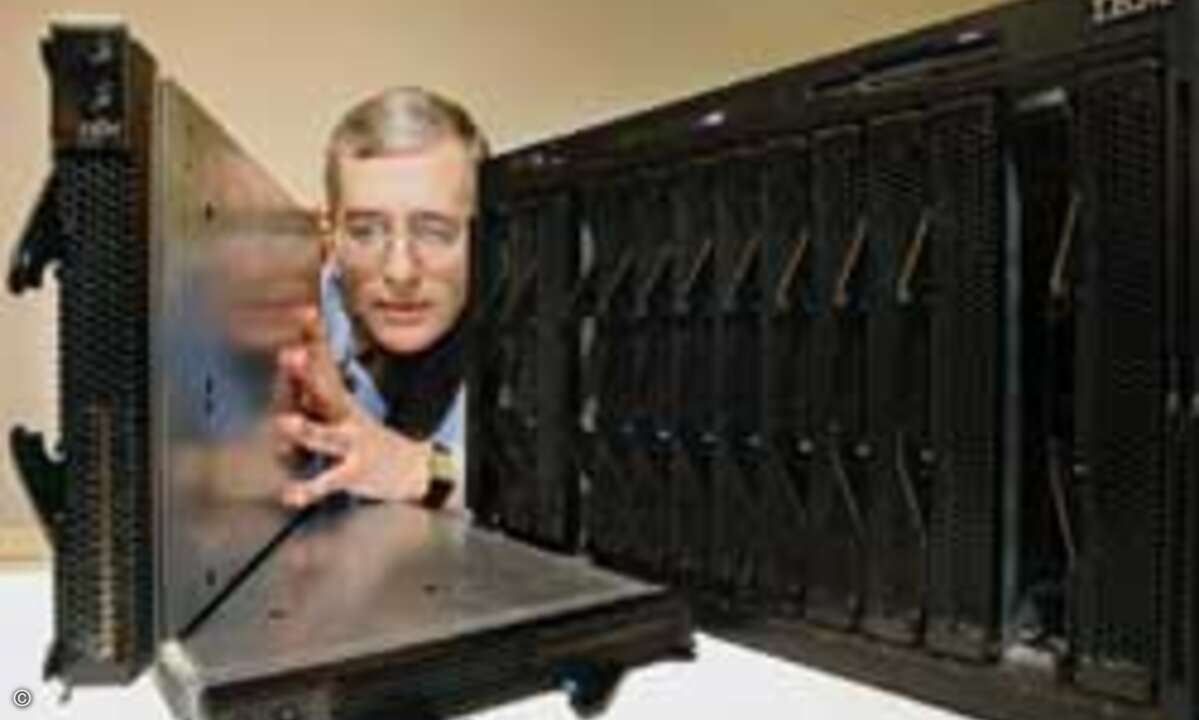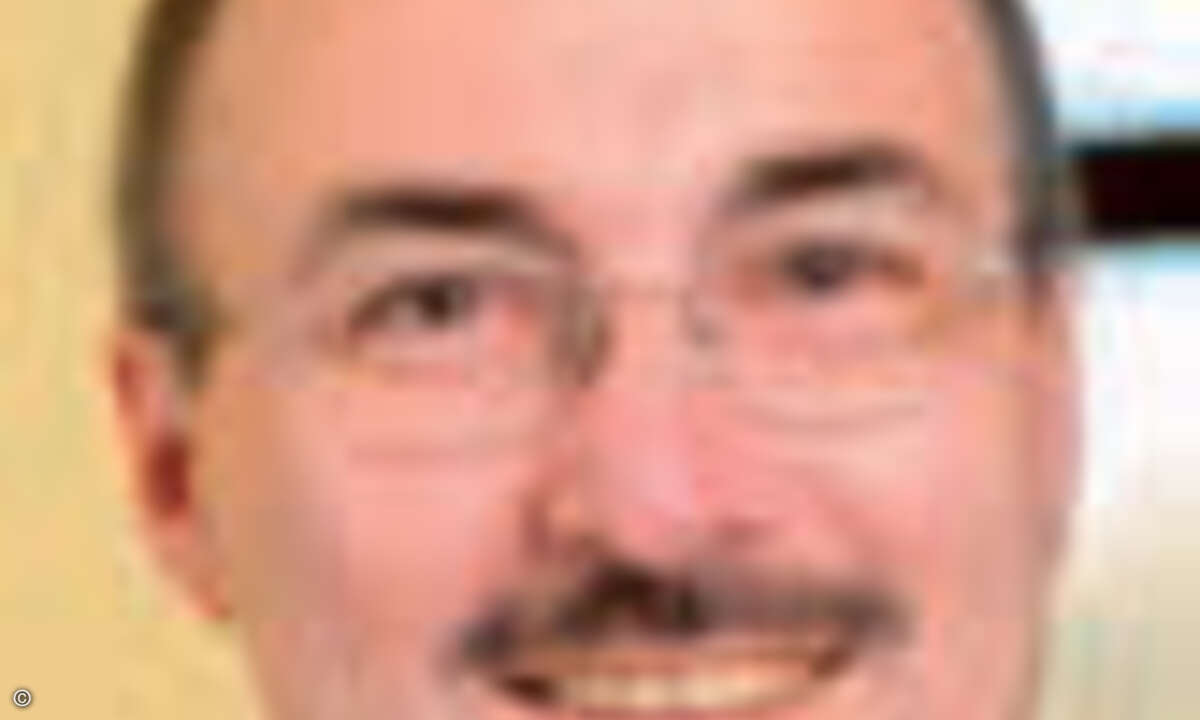IT-Zwerge im Unternehmensnetz
Blades – die Server in Minigröße – sollen im Rechenzentrum Platz einsparen und Serverfarmen mit hoher Leistungsdichte ermöglichen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten passen neue Bladegenerationen in das Bedarfsprofil der IT-Manager.

Noch vor wenigen Jahren genügten ein bis zwei simple File- und Printserver für Netzwerke mit mehreren hundert Benutzern. Doch die Anforderungen haben sich dramatisch geändert. Heute betreiben bereits kleine Unternehmen mit weniger als hundert Benutzern ganze Serverfarmen. Zu den nach wie vor benötigten Datei- und Druckservern gesellen sich Datenbank-, Terminal-, Applikationsserver und eine Gruppe von Maschinen mit Internet-, Intranet- und Extranet-Diensten hinzu. Alleine der Internet-Zugang fordert mindestens drei Server: Firewall, Postoffice und Proxy. Betreibt das Unternehmen eigene Web-Server, kommen mindestens weitere zwei bis drei Maschinen hinzu.
Das Redaktionsnetzwerk der Network Computing in Poing bei München beschäftigt beispielsweise für ganze zwölf Arbeitsplätze vier Server und dabei übernimmt jede Maschine zwei bis drei Dienste. In größeren Umgebungen wird man wohl kaum Lotus-Domino und die Fileservices auf ein und demselben Gerät laufen lassen.
Die heute notwendigen Serverfarmen beanspruchen viel Platz, erschweren das Netzwerkmanagement und lassen Spielraum für Sicherheitslücken. Verschiedene Konzepte für Blades, die Server im Miniformat, sollen hier dem Administrator und damit auch den Anwendern das Leben erleichtern. Doch nicht alle Konzepte, die in den Power-Point-Präsentationen der Hersteller so wunderbar und omnipotent erscheinen, lösen die Probleme der bestehenden Infrastrukturen. IT-Manager müssen zunächst die Anforderungen an ihre Serverfarm prüfen, bevor sie sich für neue Systeme entscheiden.
Günstig, aber weniger Leistung
Server-Blades versprechen die ultimative Leistungsdichte. Mit keinem anderen Server-Konzept lassen sich über 300 Prozessoren in ein einziges 19-Zoll-Rack zwängen. Doch die ursprüngliche Idee der Blades entstammt einem Anwendungsgebiet, das vor zwei Jahren wichtig erschien aber bis heute an Stellenwert verloren hat. Damals schrieen End- und Firmen-Anwender nach statischen Web-Servern und gerade ISPs wussten nicht mehr so recht, wo sie all diesen Plattenplatz und die Prozessorpower hernehmen sollten. Also kam das erste Value-Blade-Konzept auf den Plan. Die Grundidee bestand darin, möglichst viele aber leistungsschwache und günstige Server auf geringem Raum unterzubringen, die noch dazu Standardkomponenten wie Kühlung oder Stromversorgung gemeinsam nutzen. Ein Blade-Server besteht aus zwei Basis-Komponenten: dem eigentlichen Blade-Server mit einer herstellerspezifischen Backplane und dem Gehäuse, das die Stromversorgung sowie die Kühlung enthält und weitere Management- und Netzwerk-Komponenten einschließt.
Verschiedene Hersteller bauten schwache Uni-Prozessor-Blades mit 10/100-MBit/s-Netzwerkadaptern und 2,5-Zoll-IDE-Laufwerken. Auf Basis dieser Blades lässt sich ein Rack mit insgesamt 336 unabhängigen Servern unter Linux oder Windows realisieren. Doch die Nachteile liegen auf der Hand. Die Server liefern wenig Leistung und sind praktisch nicht skalierbar. Als Web-Server eingesetzt, eignen sich die schwachen Blades gerade mal für statische Web-Auftritte. Sites mit dynamischem Content, einer Datenbank-Engine und einem Web-Application-Server auf Basis von Java überfordern die schwachen Komponenten der Blades – und dabei sorgt nicht einmal nur die CPU für den Flaschenhals. Die simplen Notebook-Komponenten wie das IDE-Interface und die langsamen 2,5-Zoll-Platten bremsen die Performance.
Das Value-Blade-Konzept konnte sich nicht durchsetzen und Geräte dieser Klasse verschwinden vom Markt, ehe sich davon nennenswerte Stückzahlen verkaufen ließen. Ein paar wenige Anbieter bedienen den Nischenmarkt weiterhin, während andere Hersteller versuchen, Value-Blades als Client-Ersatz zu positionieren. Das macht durchaus Sinn, doch viele Administratoren wollen von der eingeführten Fat-Client-Umgebung nicht weichen. So problematisch das bekannte Szenario mit Arbeitsplatz-PCs auch sein mag, so gut hat es sich etabliert, und weder Thin-Clients noch Client-Blades können dem ausgewachsenen Desktop-PC den Rang streitig machen.
Weniger kompakt – mehr Power
Diese offensichtlichen Schwächen des simplen Value-Blade-Konzeptes sollen neuerdings kräftigere Systeme vermeiden. Unternehmen wie Dell, Fujitsu Siemens, Hewlett-Packard, IBM oder Sun offerieren Power-Blades. Die Grundidee der Power-Blades gleicht der der simplen Blades, nur dass man etwas weniger, dafür aber deutlich leistungsstärkere Server in ein Gehäuse packt. Alle Konzepte fassen dabei nur zwischen vier und zehn Blades in einem Enclosure. Jeder dieser Blades-Server beherbergt dafür ein bis vier ausgewachsene Server-CPUs – beispielsweise Xeon, Ultrasparc-III oder Opteron –, bis 16 GByte RAM und variierende Festplatten-Ausrüstungen. Je nach Hersteller und Blade-Modell erhält der Anwender gespiegelte 2,5-Zoll-IDE-Laufwerke oder hochtourige Ultra-SCSI-Laufwerke. An Stelle der drei 10/100-MBit/s-Interfaces treten zwei Gigabit-Ethernet-Adapter. Neue Blades verfügen auch über SAN-Interfaces. Neben der Option des iSCSI-Protokolls auf den Ethernet-Schnittstellen bieten verschiedene Hersteller Fibre-Channel/AL-Adapter auf dem Blade an und führen die SAN-Connectoren zu einem integrierten Switch oder an passende Fibre-Channel-Stecker. Um die Zuverlässigkeit der Blade-Server zu erhöhen implementieren verschiedene Hersteller in ihre Blade-Konzepte Duale-Backplanes. Dabei führt jedes Blade alle Konnektoren doppelt auf zwei voneinander unabhängige Backplanes heraus. Somit kann ein havarierendes Blade oder ein Ausfall des Backplane nicht das ganze Rack gefährden.
Von dem Gedanken, das standardisierte ATCA-Backplane (Compact-PCI-3) für Blade-Server zu nutzen, sind die Hersteller in der Zwischenzeit abgerückt. Nur wenige Anwender würden Blades verschiedener Hersteller zusammen in einem Enclosure betreiben. Der ATCA-Connector standardisiert zudem zu wenige I/O-Kanäle, so dass sich die Blade-Hersteller auf eine einheitliche Belegung der User-Ports des ATCA-Busses einigen müssten. Aus diesem Grund ziehen es die Hersteller vor, eigene Backplanes zu entwerfen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Um Blade-Designs anderer Hersteller zu ermöglichen, geben einige Unternehmen ihr Backplane-Layout an Drittanbieter weiter. Für Suns Blade-Center offerieren Drittanbieter beispielsweise spezielle Funktionsblades, wie SSL-Acceleratoren.
Das Design der Backplanes passt sich dabei auch an das Einsatzgebiet an. Während einige Blade-Schmieden flache Blades mit großer Tiefe vorziehen, setzen andere auf hohe Blades in Racks mit geringerer Tiefe. Während die langen Blades ein einfacheres Handling und eine größere Leistungsdichte versprechen, eignen sich die kurzen zum Einsatz im Telko-Umfeld. Dort kommen durch die Bank Racksysteme mit geringer Bautiefe zum Einsatz.
Während Value-Blades nur für simple ISPs taugen, finden sich für Power-Blades genügend Anwendungsgebiete im Unternehmens-LAN. Ein Gehäuse mit sechs Blades kann hier als Terminal-Server-Cluster mit Citrix für gut und gern 300 Benutzer auftreten. Verstärktes Interesse an Blades zeigen auch Anwender im SAP-Umfeld. Hier dienen Blades als Application-Server für einzelne R3- oder MySAP-Software-Module. Gerade Banken und Versicherungen favorisieren derzeit leistungsstarke Blade-Farmen für diese Aufgaben.
Auch der Einsatz als Notes- oder Exchange-Cluster für größere Mail- oder Groupware-Server-Installationen wäre denkbar. Doch hier zeigen sich andere Schwächen. Der interne Massenspeicher der Blades ist begrenzt. Nun kann man die Blades mit großen Laufwerken bestücken. Das geht aber richtig ins Geld, wenn man jeden Blade-Server mit zwei gespiegelten 72-GByte-Laufwerken versieht. Zudem verschenkt man Unmengen an Kapazität für die Redundanz. Heute nutzen Unternehmen in ihren Servern im Regelfall zwei vergleichsweise kleine Laufwerke mit Spiegelung für das Betriebssystem und die wichtigsten Applikationen. Die Daten lagern hingegen auf geräumigen RAID-5-Verbänden in DAS- oder SAN-Speichern. DAS-Geräte lassen sich dabei aber kaum an Blades anbinden. Hier benötigen die Anwender eine SAN-Infrastruktur, sei es mit verhältnismäßig teuren Fibre-Channel-Komponenten oder auf Basis des langsameren aber preisgünstigeren iSCSI.
Unabhänging von der Hardware-Architektur spielt bei den Blades die Management-Software eine große Rolle. Wer jeden einzelnen Blade manuell einrichten und konfigurieren muss, verliert schnell die Lust am Konzept und verbraucht Unmengen an Arbeitszeit. Die Hersteller bieten daher durch die Bank spezielle Management-Tools, die automatische Verteilung von Betriebssystem-Images (Linux/Windows) nebst Applikationen und Benutzerdaten erlauben.
Netzwerk-Design neu definiert
Durch ihre geringe Größe versprechen Blades ein völlig neues Design des Sever-Raums. Die Server in Steckkartengröße stehen vertikal im Gehäuse, das auch mit der Verkabelung, der Kühlung und der Stromversorgung ausgestattet ist. Das Chassis wiederum kommt in Racks unter, wobei ein Rack mit Hunderten von Blades ausgestattet sein kann. Damit sollen die Miniserver das Setup vereinfachen, Raum sparen und – bei einigen Modellen – das Hitzeaufkommen senken, indem Low-Power-Prozessoren zum Einsatz kommen.
Blades sollen dem Server-Geschäft zu neuem Aufwind verhelfen. IDC prognostiziert sogar, dass einer von fünf Servern bis zum Jahr 2006 ein Blade-Server sein wird. Andere Analysten sind der Ansicht, dass der Umsatz mit Blades den Verkauf von 1-HE-Servern übersteigen wird. Diese machen immerhin ein Drittel aller verkauften Server aus. [ ast ]