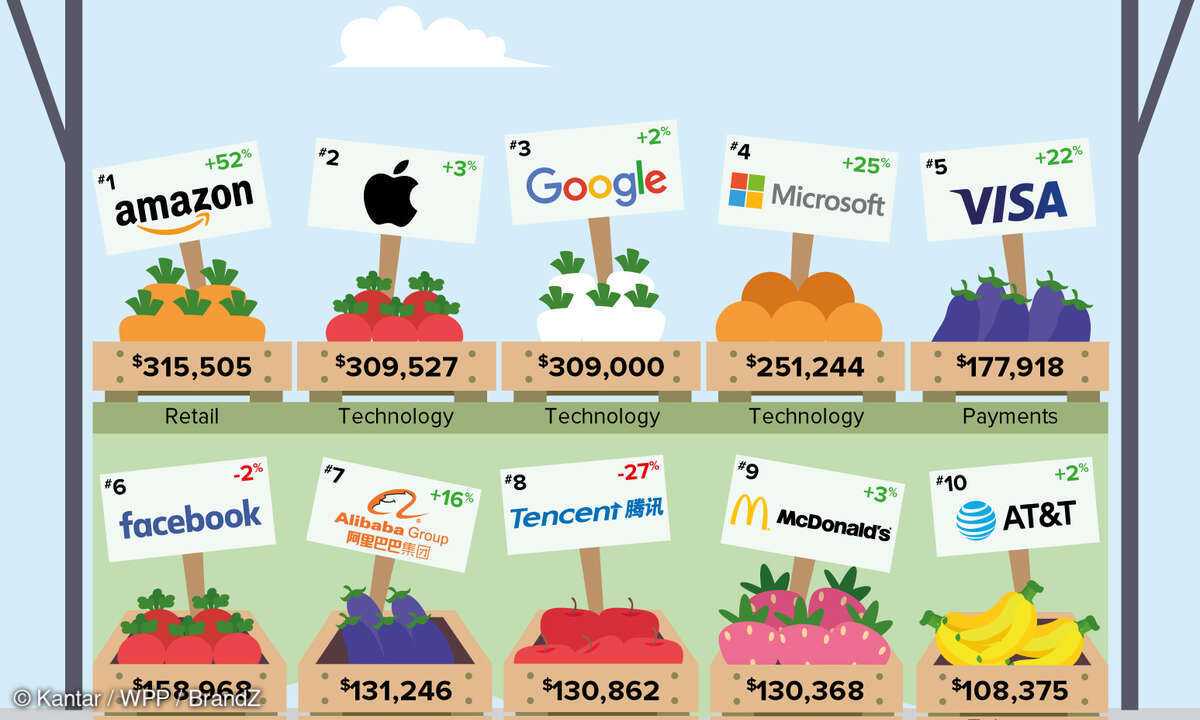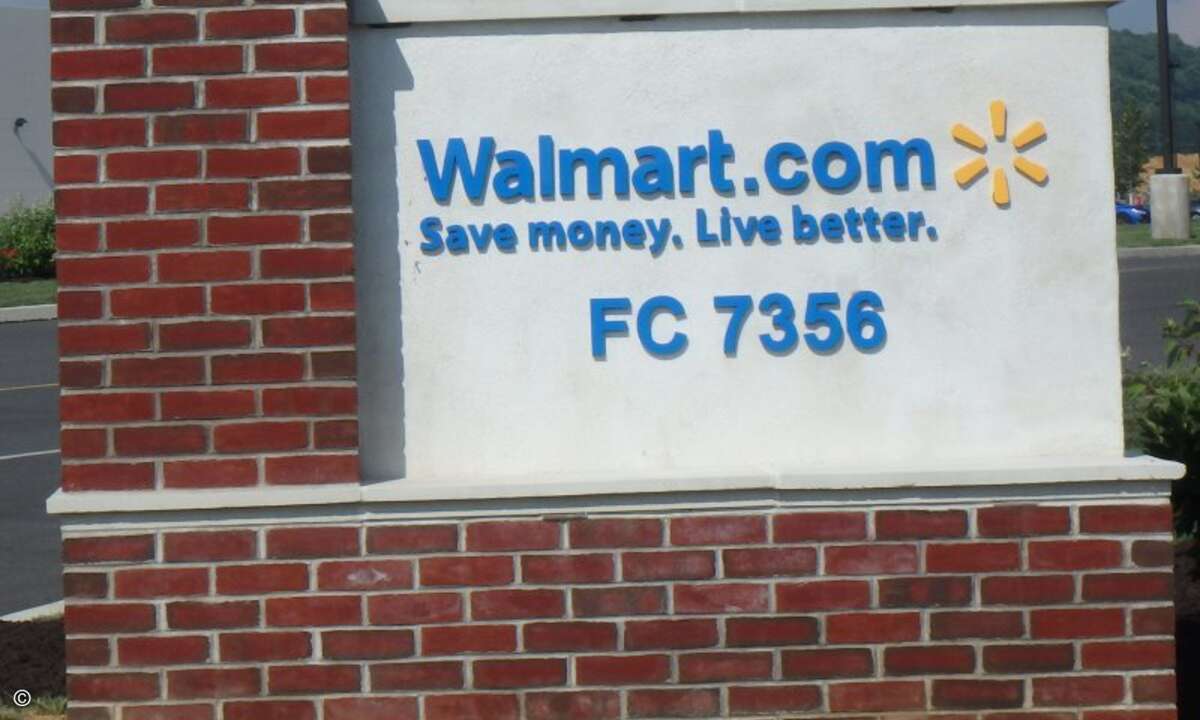Der Fuchs bellt nicht, wenn er das Lamm stehlen will
Nicht nur die Sprachassistenten hören hin, wenn sie aktiviert werden. Auch der eine oder andere Mensch spitzt die Ohren und transkribiert im Auftrag der Anbieter die Kommandos. Nutzern war das aufgrund mangelhafter Aufklärung seitens der Anbieter nicht klar. Ein Umstand, der für Zündstoff sorgte.

Das war in den 1960er-Jahren zweifellos eine aufregende Zukunftsmusik, als die Stimme von Majel Barrett-Roddenberry aus dem Computer der Enterprise hallte und auf Captain Kirks Wortkommandos oder Fragen reagierte. Was Gene Roddenberry für das 22. Jahrhundert angedacht hatte, wurde schneller zur Realität als gedacht. Inzwischen haben Spracherkennung und -steuerung unseren Alltag in großem Stil erobert.
Digitale Assistenten sind schon eine praktische Sache. Sie spielen auf Kommando die Wunschmusik ab, hat man gerade keine Hände frei, schalten sie das Licht ein- oder aus und sie beantworten jedwede Fragen. Die digitalen Helferlein aus dem Kasten sind 24/7 zu Diensten. Wie gute Butler sind sie stets anwesend, warten auf ihr Aktivierungswort und in der Zwischenzeit halten sie sich so bedeckt, dass man ihre Präsenz vollkommen vergisst. Aus diesem Grund ist Diskretion gefragt. Wer will schon einen Butler, der alles ausplaudert. Von Siri & Co. sollte man das auch annehmen – vor allem, weil es keine Menschen sind. Weit gefehlt!
Ein Satz heiße Ohren
Zur Verbesserung der Spracherkennungs-Algorithmen ließen Amazon, Apple und Google bis vor Kurzem noch Transkripte von einem Teil der Aufnahmen erstellen. Die Auswertung erfolgte dabei unter anderem durch Menschen. Amazon setzte für diesen Zweck neben hauseigenen Mitarbeitern auch auf Zeitarbeiter in Polen von der Firma Randstad, wie die Welt am Sonntag berichtet. Korrekturhörer in geschützten Büros suchte man hier vergebens. Gleiches gilt für strenge Zugriffsbeschränkungen. Vielmehr wurden den Recherchen der Zeitung zufolge die Transkripte stellenweise am heimischen Küchentisch erledigt. Zu hören bekamen die externen Mitarbeiter auch sensible personenbezogene Informationen aus der Privat- oder Intimsphäre der Nutzer. Dieser Umstand ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass auch Sprachassistenten nicht immer richtig hinhören und gegebenenfalls eine fehlerhafte Aktivierung starten. In der Folge wurden dann Inhalte aufgezeichnet, die nicht für ihr Ohr bestimmt waren. Darüber hinaus ist einem Bericht vom Frühjahr dieses Jahres des Finanzdienstleisters Bloomberg über Amazons Echo-Lautsprecher zu entnehmen, dass die Dienstleister teilweise auch die Seriennummern der Geräte sowie die Vornamen der Nutzer angezeigt bekommen. Von Anonymisierung kann deshalb zumindest im Fall Amazon keine Rede sein.
Den Auftakt für den einstweiligen Transkriptionsstopp, der vorerst auf freiwilliger Basis seitens der Unternehmen besteht, bot laut der Süddeutschen Zeitung ein Fall aus den Niederlanden. Dort tauchten Mitschnitte vernetzter Google-Home-Lautsprecher auf und boten Zündstoff für heftige Diskussionen. Darüber hinaus hat der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Dr. Johannes Caspar, ein Verwaltungsverfahren gegen Google eingeleitet, das das Verbot des Anhörens von Sprachaufnahmen durch Google-Mitarbeiter oder Dienstleister zum Ziel hat. Caspar plädiert dafür, derartige Maßnahmen auch gegen die Anbieter anderer Sprach-assistenten durchzusetzen.
Schweigen ist nicht immer Gold
Die Stellungnahmen der Unternehmen zu den Vorwürfen sind weitaus blutleerer und einsilbiger als die Antworten ihrer Sprachassistenten. Es wird herumgedruckst und letzten Endes herrscht Unverständnis darüber, dass sich Nutzer auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie durch das Mithören teilweise vertraulicher Gespräche einen Beitrag zur Optimierung dieser Systeme leisten. In diesem Zusammenhang betont Google, man kooperiere mit Sprachexperten auf der ganzen Welt, um die Sprachtechnologie zu optimieren. Und Amazon lässt verlauten: „Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, Kunden einen besseren Zugang zu Informationen über die Funktionsweise von Alexa zu geben.“ Auf das eigentliche Problem der Nutzer, das Eindringen in deren Privatsphäre, wird in keinem verfügbaren Statement der betreffenden Unternehmen eingegangen.
Der Skandal besteht aber noch nicht einmal darin, dass die Gespräche zur Verbesserung des Service von Menschenhand ausgewertet werden. Vielmehr ist es das jahrelange Schweigen seitens Amazon, Google und Apple darüber, das für Entsetzen sorgt. Fakt ist, dass die Nutzer bislang nur indirekt und sehr undurchsichtig über eventuelle Mitschnitte in Kenntnis gesetzt wurden. So heißt es nun erstmals in der Amazon-App: „Ein sehr kleiner Anteil der Sprachaufzeichnungen wird manuell überprüft“. Pikant ist dort auch die Platzierung eines Warnhinweises über dem Software-Schalter, der zum Abschalten der Auswertung dient. Dieser informiert darüber, dass im Falle eines Ablehnens möglicherweise einzelne Funktionen nicht mehr verfügbar sind.
Über Details zum tatsächlichen Umgang mit den Daten verloren Google, Apple und Amazon bis dato kein Wort. Das wollen sie jetzt ändern und die ausdrückliche Erlaubnis für die Nutzung der Daten bei den Kunden einholen. Aber warum erst jetzt, nachdem sich die Medien zum Thema mit Schlagzeilen überboten haben? Die betreffenden sprachgesteuerten Assistenten sind doch schon mehrere Jahre auf dem Markt. Wie schrieb William Shakespeare einst so schön in seinem Historiendrama König Heinrich IV. „Der Fuchs bellt nicht, wenn er das Lamm stehlen will.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.