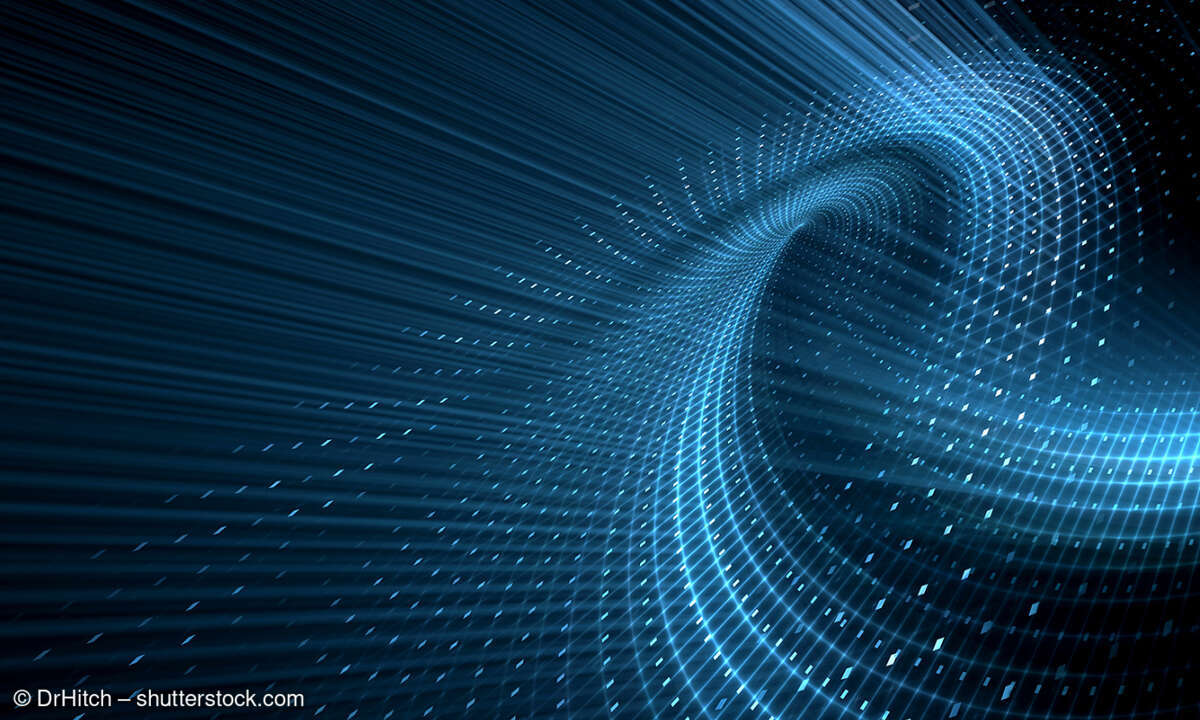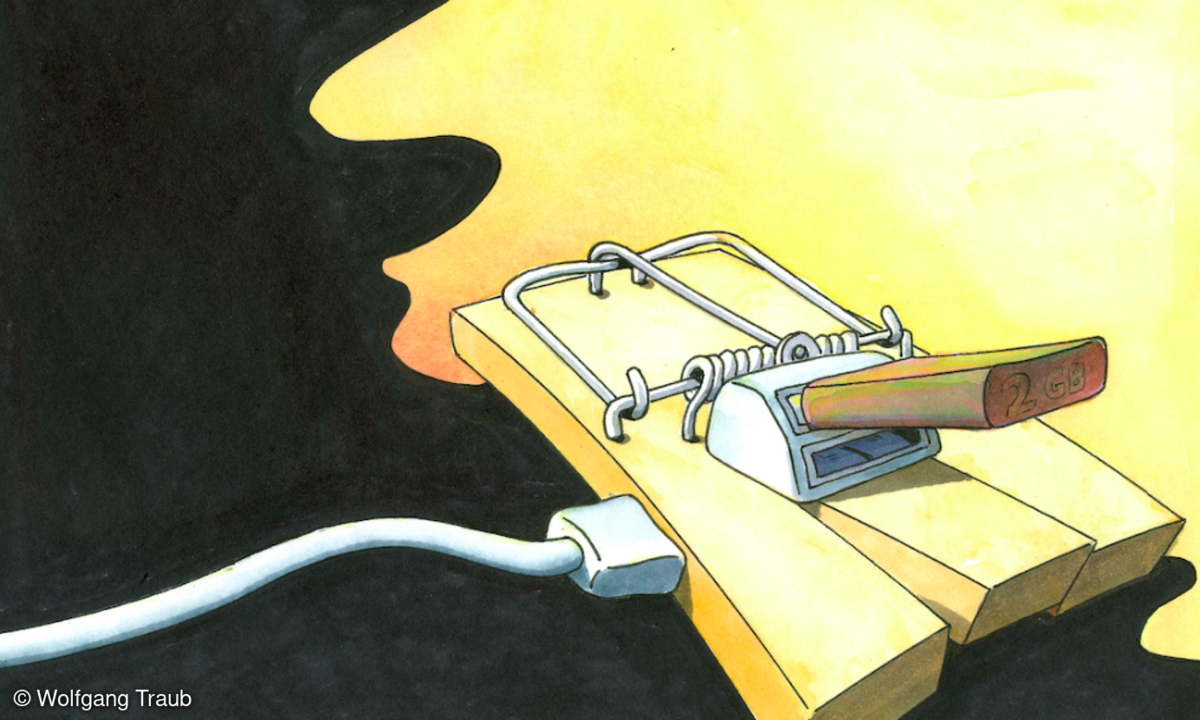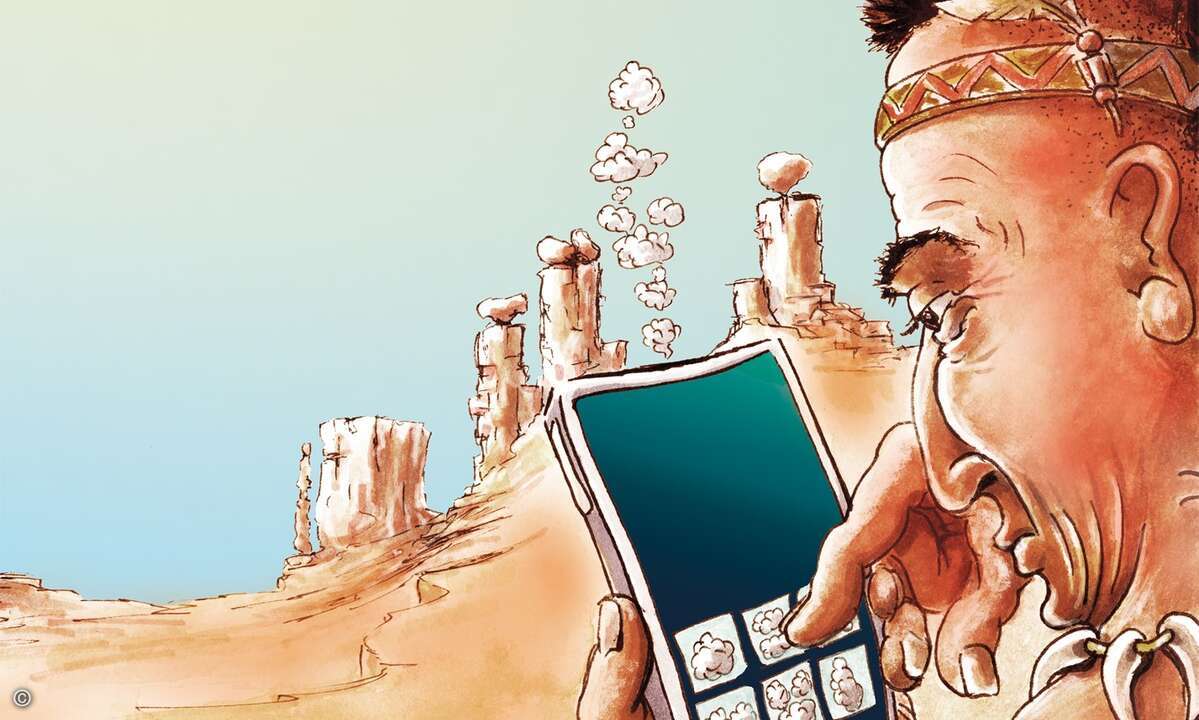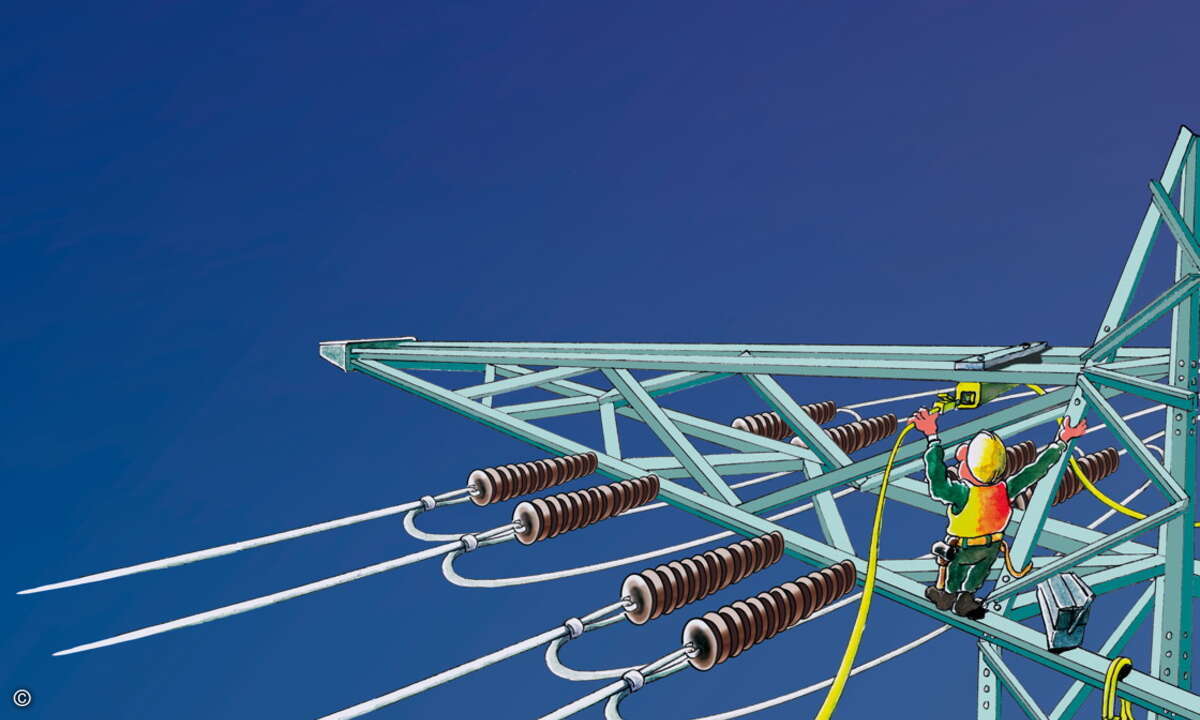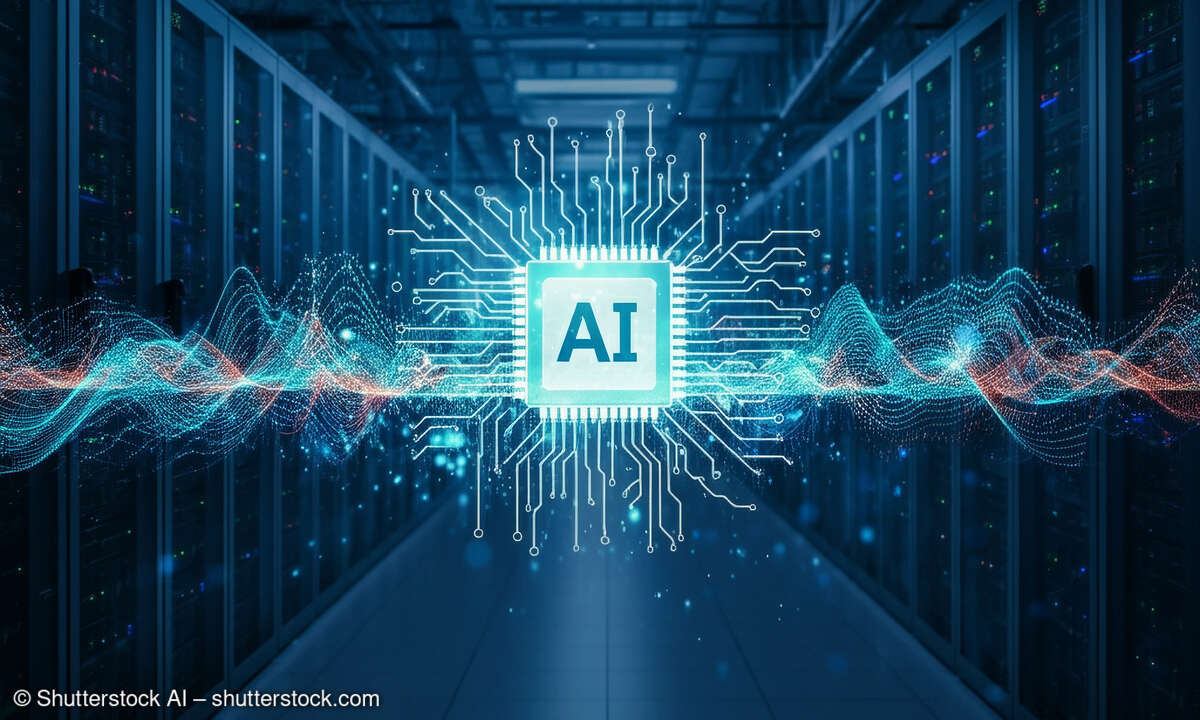Dem Computer beim Denken zuschauen
Neuronale Netze werden heute für die Analyse komplexer Daten eingesetzt. Letztlich aber weiß niemand, wie diese Netzwerke eigentlich genau arbeiten. Fraunhofer-Forscher haben deshalb eine Software entwickelt, mit der sie in die Black-Boxes hineinschauen und deren Arbeitsweise analysieren können.
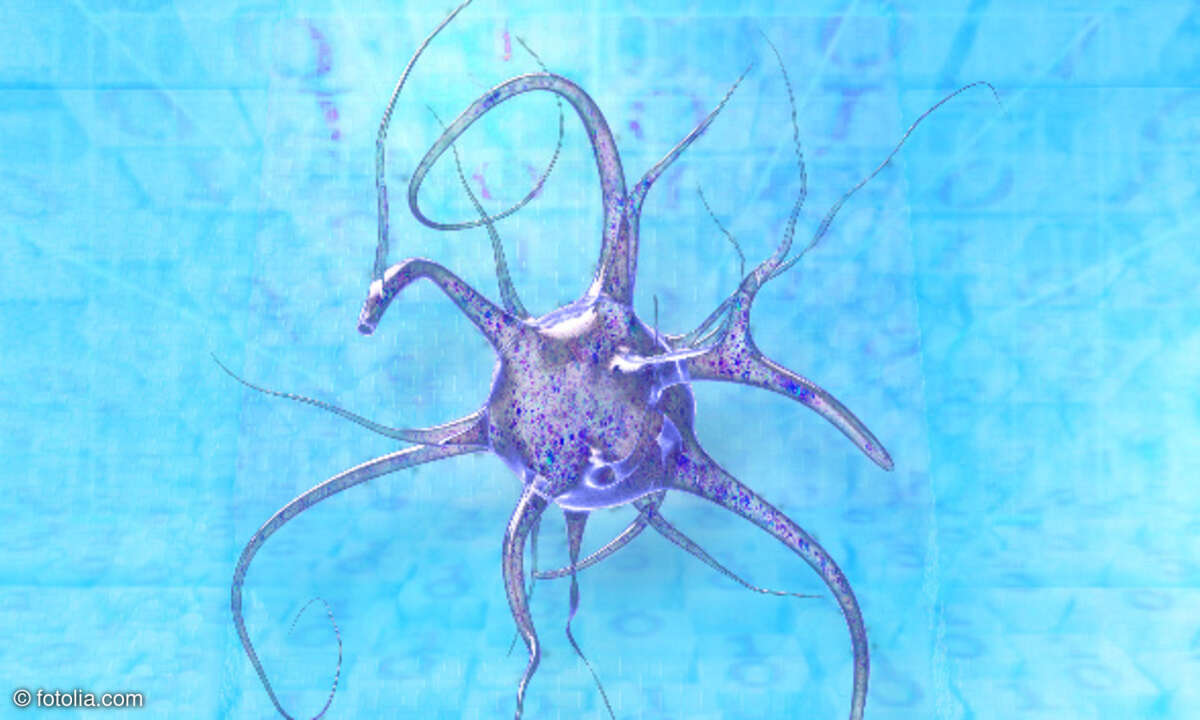
- Dem Computer beim Denken zuschauen
- Neuronale Netze im Rückwärtsgang
“Früher war es mühsam, im Computer Fotos zu sortieren. Heute klickt man auf die Gesichtserkennung – und flugs erscheint eine Bildauswahl der Tochter oder des Sohnes”, so das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI. Computer sind inzwischen gut darin, große Datenmengen zu analysieren und nach bestimmten Strukturen wie einem Gesicht auf Bildern zu fahnden. Möglich machen das neuronale Netze, ein inzwischen etabliertes und ausgefeiltes informationstechnisches Analyseverfahren.
Das Problem laut Fraunhofer HHI: man weiß nicht genau, wie neuronale Netze Schritt für Schritt arbeiten und wieso sie zu diesem oder jenem Ergebnis kommen. Neuronale Netze sind gewissermaßen Black-Boxes, Computerprogramme, in die man Werte einspeist und die zuverlässig Ergebnisse liefern. Will man einem neuronalen Netz etwa beibringen, Katzen zu erkennen, dann lernt man das System an, indem man es mit Tausenden von Katzenbildern füttert. Wie ein kleines Kind, das langsam versteht, Katzen von Hunden zu unterscheiden, lernt auch das neuronale Netz automatisch, heißt es.
“In vielen Fällen aber interessieren sich Forscher weniger für das Ergebnis, sondern vielmehr dafür, was das neuronale Netz eigentlich tut, wie es zu Entscheidungen kommt”, so Dr. Wojciech Samek, Leiter der Forschungsgruppe für Maschinelles Lernen am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut HHI in Berlin. Samek und seine Kollegen haben deshalb zusammen mit Kollegen von der Technischen Universität Berlin – Prof. Dr. Klaus-Robert Müller - eine Methode entwickelt, mit der man einem neuronalen Netz beim Denken zuschauen kann.
Das sei beispielsweise für die Erkennung von Krankheiten wichtig. Heute kann man Computer beziehungsweise neuronale Netze bereits mit den Erbgut-Daten von Patienten füttern, heißt es dazu und weiter: Das Netzwerk analysiert dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Patient eine bestimmte genetische Erkrankung hat. “Viel interessanter wäre es aber, wenn wir genau wüssten, an welchen Merkmalen das Programm seine Entscheidungen fest macht”, sagt Samek. Das könnten bestimmte Gendefekte sein, die bei dem Patienten vorliegen – und die wiederum könnten ein möglicher Angriffspunkt für eine individuell auf den Patienten zugeschnittene Krebstherapie sein.