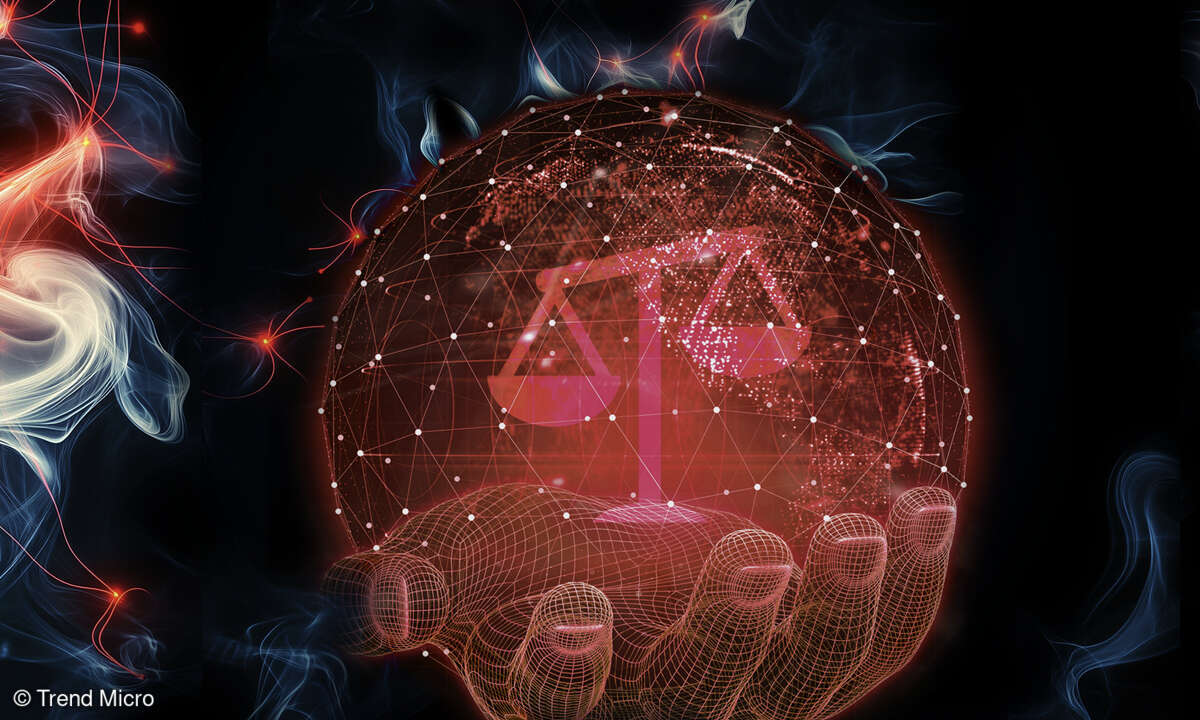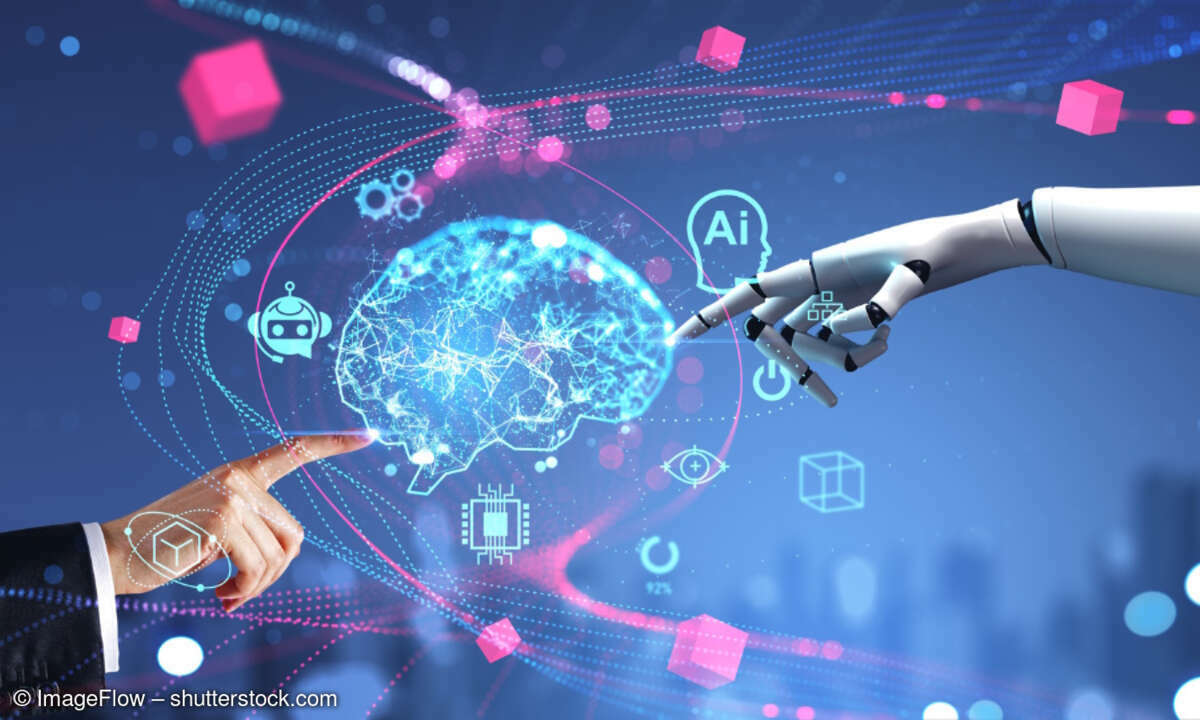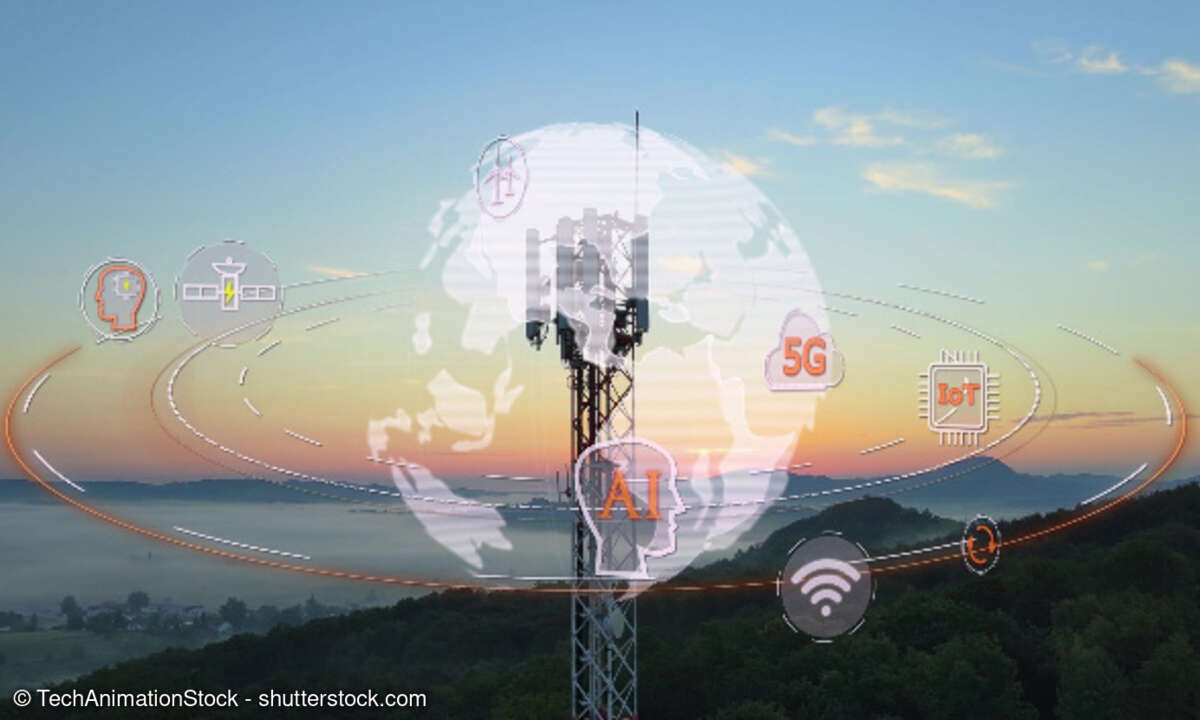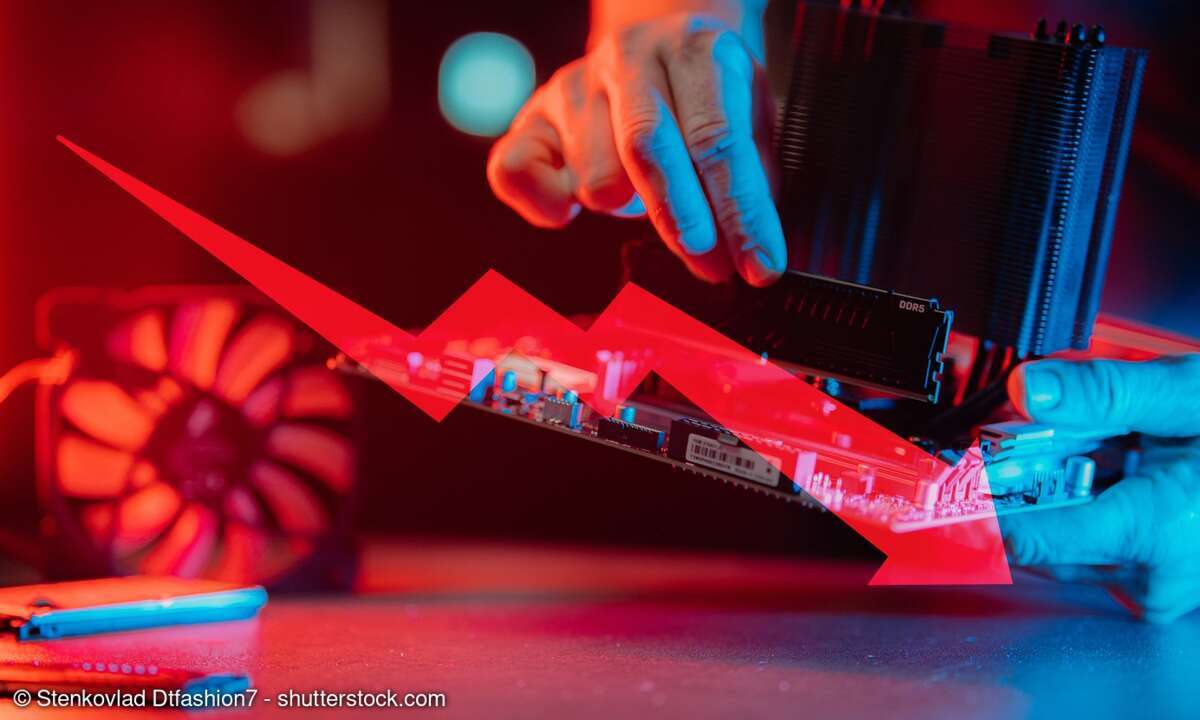Anwenderfreundlich denken
- Intelligenz setzt sich durch
- Anwenderfreundlich denken
- Erfolgsfaktor Zeit
- Jenseits der Finanzabteilung
- Wie geht es weiter?
Obwohl BI-Anwendungen in steigendem Maße anwenderfreundlich werden, stellen sie die meisten Angestellten aus nicht-technischen Bereichen noch immer vor erhebliche Probleme. Das gilt im Speziellen, wenn die BI-Plattformen profundes Wissen über die zugrunde liegenden Datenmodelle, Metadaten und Datenbankschemata voraussetzen. Denn es erfordert einiges an Training, bis ein Endanwender versteht, wie er die Anwendung einsetzen kann, um beispielsweise nachzuforschen, warum ein BI-Dashboard zeigt, dass in einer bestimmten Niederlassung die Lohnkosten in Relation zu den Verkäufen auffällig hoch sind. Wenn aber BI täglich schnelle Entscheidungen über die Verteilung von Inventar und Ressourcen ermöglichen soll, dann dürfen die Anwender nicht dazu genötigt werden, sich auf der Suche nach Antworten durch einen Wust von irrelevanten Daten wühlen zu müssen, oder bei der Nachforschung von der Hilfe der IT-Abteilung abhängig zu sein. Die Hersteller von BI- und Analyseprogrammen kennen diese Bedürfnisse und gestalten deshalb ihre Anwendungen immer selbsterklärender und anwenderfreundlicher, doch oft übersehen sie dabei, dass Manager und leitende Angestellte schon immer ihre eigenen Methoden angewendet haben, um an die benötigten Informationen zu kommen und diese auch zur Entscheidungsfindung zu nutzen. Entweder wurde die IT-Abteilung beauftragt, eine proprietäre Anwendung zu programmieren, die bereits existierende Methoden automatisiert, oder die Manager selbst wurden zu Meistern der Tabellenkalkulation. Einige verließen sich auch einfach auf ihren Instinkt. So oder so, alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. BI entwickelt sich dort besonders gut, wo Führungskräfte, Manager und Analysten bereit sind, die gängigen Abläufe zu hinterfragen. Doch nicht in allen Unternehmen ist man so abenteuerlustig. Deshalb gehen BI-Anbieter dazu über, sich durch die Hintertür in das Anwendungs-, Service- und Prozessumfeld zu schleichen, in dem sich die Angestellten täglich bewegen. Dort werden BI- und Performancemanagement-Dashboards als Komponenten von Unternehmensportalen oder anderen Interfaces eingesetzt.
Gesetzliche Bestimmungen Es lässt sich nicht vermeiden, dass durch BI generierte Aggregationen und andere, dazwischenliegende analytische Daten, heikle oder geheime Informationen beinhalten, was bedeutet, dass jede BI-Anwendung das Thema Sicherheit und Datenschutz adressieren muss. Die meisten Anbieter beherzigen zwar die Best Practices der Datenbank- und Netzwerksicherheit, doch bei neueren Systemen wird das immer schwieriger. Der wirkliche Knackpunkt ist aber die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Um Bestimmungen wie den Sarbanes-Oxley Act oder Basel II befolgen zu können, brauchen Unternehmen eine bessere Buchungskontrolle, höhere Datenqualität und verstärkte Datensicherheit. Es muss auch möglich sein, festzustellen, welche Information und welche Analyse zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben. BI und Data Warehousing sind wertvolle Instrumente, um die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen zu verbessern, aber gleichzeitig setzt die Analyseaktivität die IT-Leiter auch unter Druck, die Datenquellen vor Aggregationen, Lastspitzen oder verdächtigen Anfragen zu schützen. Die gesetzlichen Bestimmungen führen dazu, dass einige BI-Anbieter, die bisher auf Performance-Management spezialisiert waren, ihr Portfolio über die passive, strategische Geschäftsanalyse hinaus verbreitern. Durch Kooperationen mit Suchmaschinenanbietern dringt die BI auch zu unstrukturierten Daten wie beispielsweise Office-Dokumenten, E-Mails oder Voicemails vor. Statt sich auf separate Transaktionen zu konzentrieren, muss BI in der Lage sein, in einer riesigen Menge von Daten einzelne Ereignisse zu verstehen, um Betrugsversuche abwehren zu können, die Datensicherheit zu gewährleisten, oder neue Geschäftsaktivitäten wie RFID-Erfassung oder Algorithmischen Handel zu unterstützen.