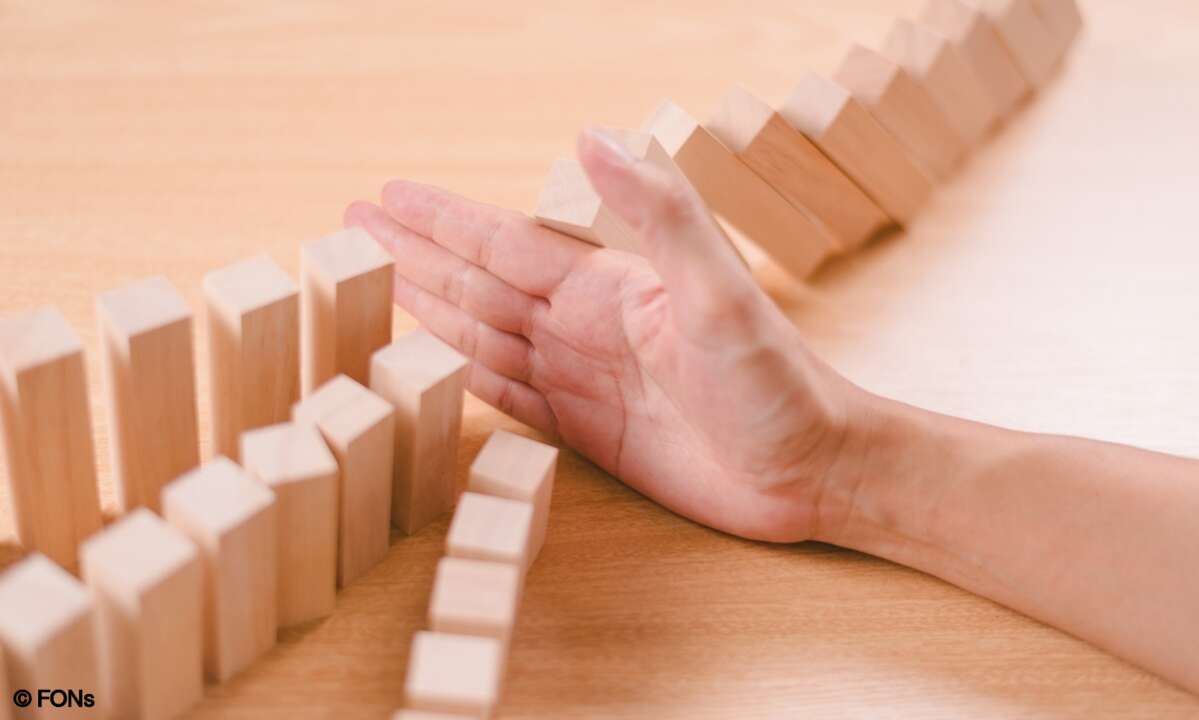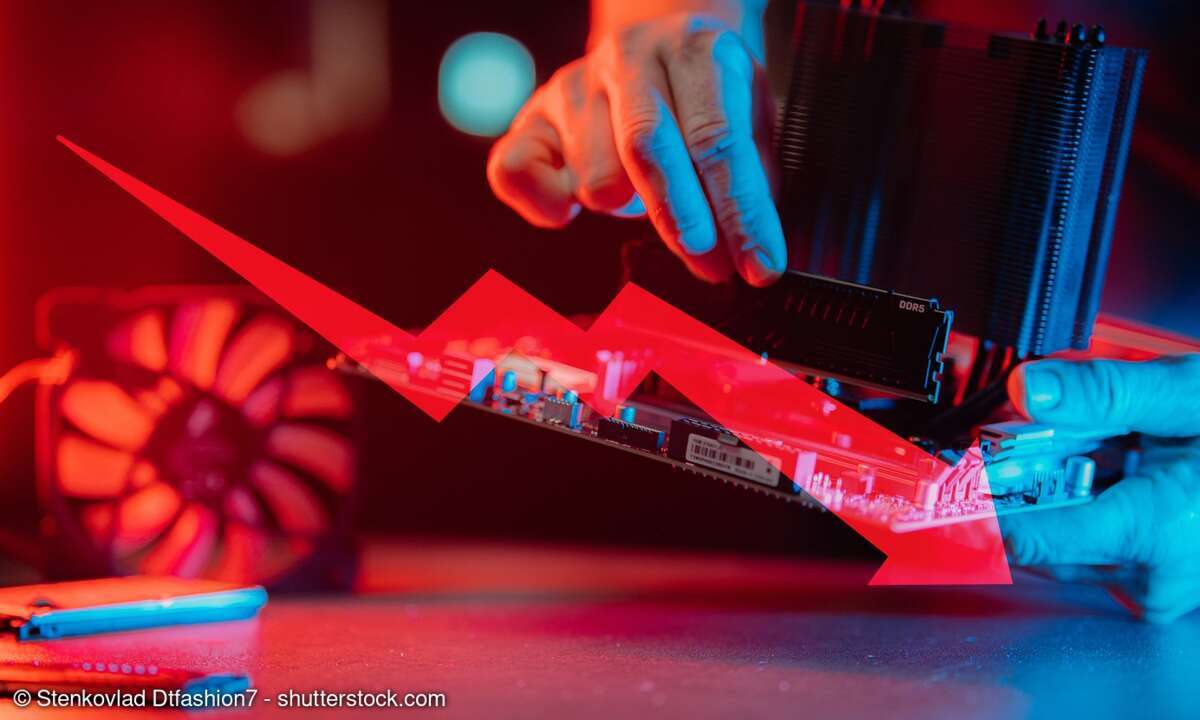Portaltechnik mit Ampeln
- Prozessorientierte (Konflikt-)Potenziale
- Portaltechnik mit Ampeln
- Mittelständler im Vorteil
Die technische Grundlage für eine enge Verzahnung von Geschäftsprozessen und IT-Abläufen ist in den letzten Jahren durch immer neue Module im Bereich Business Service Management (BSM) gelegt worden. Hier haben sowohl die Marktschwergewichte IBM, HP, CA, BMC und Microsoft entsprechende Angebote als auch aufstrebende Firmen wie Realtech. Wenn man es vereinfacht ausdrücken will, dann kombinieren solche BSM-Angebote die traditionellen Module aus dem Bereich Netzwerk- und Systemmanagement mit ausgereiften Helpdesk-Systemen auf der Basis von ITIL sowie (gesetzlichen) Richtlinien-Katalogen wie Euro-Sox, MiFID oder Cobit. Das ist die Geschäftsseite. Auf der IT-Seite erweitern BSM-Systeme die traditionellen Netzwerk- und Systemmanagement-Pakete um ausgeklügelte Verfahren der Datenanalyse (Business Intelligence) und flexible Anwendungsstrukturen, bei denen die Nutzer nicht auf Applikationen, sondern auf Services aufsetzen (Serviceorientierte Architekturen, SOA). Auf der Basis solcher Techniken lassen sich Kennzahlen festlegen, mit denen sinnvolle Aussagen über den Grad der Verzahnung der Geschäftsprozesse mit den IT-Modulen möglich sind. Über entsprechende Messpunkte können dann die Leistung des Systems sowie die Qualität der Services bestimmt werden. Diese Messungen wiederum dienen als Grundlage für realistische Leistungsvereinbarungen (SLAs). Mit den Messpunkten lässt sich nicht nur die Verfügbarkeit kritischer IT-Komponenten oder einer bestimmten IT-Dienstleistung ermitteln, sondern mithilfe entsprechender Algorithmen in der BSM-Lösung beispielsweise auch die Zeit ermitteln, die eine bestimmte Ware von der Verfügbarkeitsmeldung bis zur Übergabe an den Logistikpartner benötigt. BSM-Anbieter wie Realtech ermöglichen mithilfe der Portaltechnik eine übersichtliche Darstellung und Analyse kritischer Geschäftsprozesse auf allen Detailebenen bis zu der darunter liegenden IT-Infrastruktur. Ist ein Gesamtprozess oder auch nur einer der Teilprozesse gestört, wird dies sofort mit den üblichen Ampelfarben angezeigt. Das IT-technische Handwerkszeug für eine prozesstechnische Erneuerung liegt damit bereit. Aber letztere muss in den Unternehmen organisatorisch umgesetzt werden. Eine solche Umsetzung kommt übrigens nicht nur der Leistungsfähigkeit des Gesamtunternehmens zugute, sondern hilft auch der IT-Abteilung, denn nur auf diesem Weg kann diese überhaupt ihren Wertbeitrag nachweisen. Die Autoren der Lünendonk/Realtech-Studie beschreiben die organisatorische Herkules-Aufgabe und die damit einher gehenden Konfliktpotenziale. »Für die Unternehmen bedeutet die enge Verzahnung von Geschäftsprozessen und IT-Services neben einer neuen Organisationsstruktur auch ein Umdenken bezüglich der Führungsinstrumente und das Schaffen von erforderlichen Kompetenzen bei den Führungskräften«, schreiben sie in ihrem Resümee und erläutern auch den dabei entstehenden menschlichen Konfliktstoff: »Galt früher beispielsweise die Zahl der Mitarbeiter eines Bereichs als Gradmesser für die Hierarchie im Management, kann in einer prozessorientierten Organisation beispielsweise die Bedeutung des jeweiligen Prozesses darüber entscheiden, wer welche Entscheidungskompetenzen erhält.«