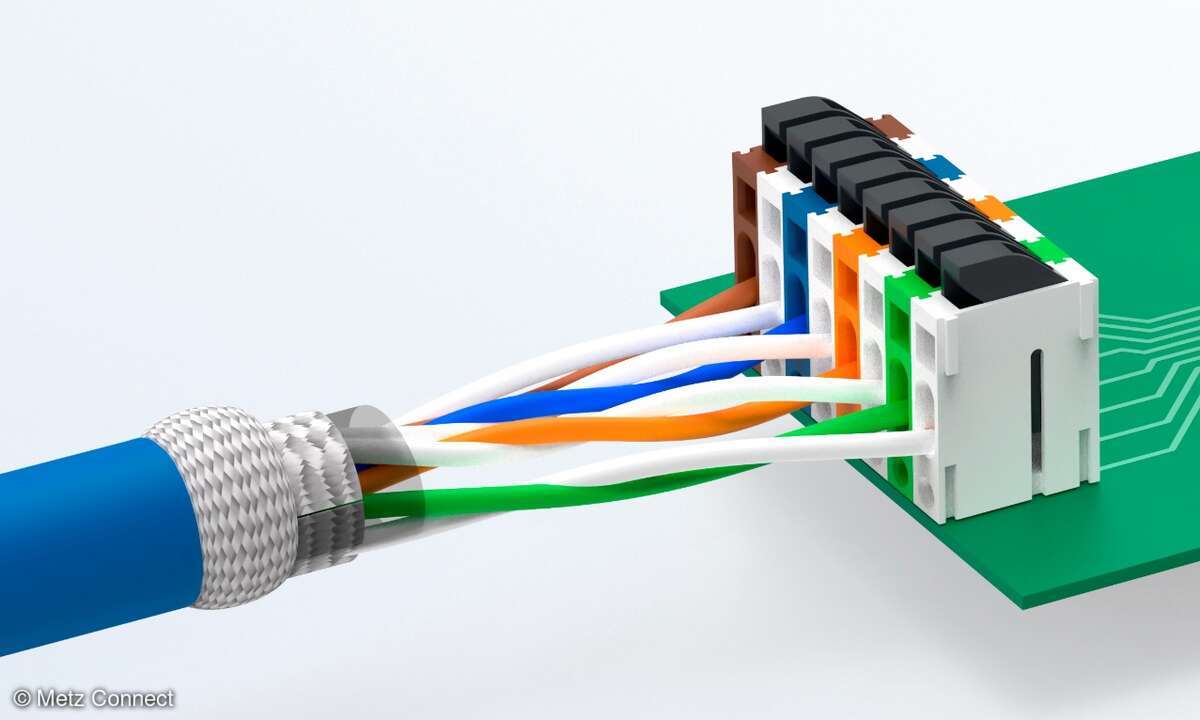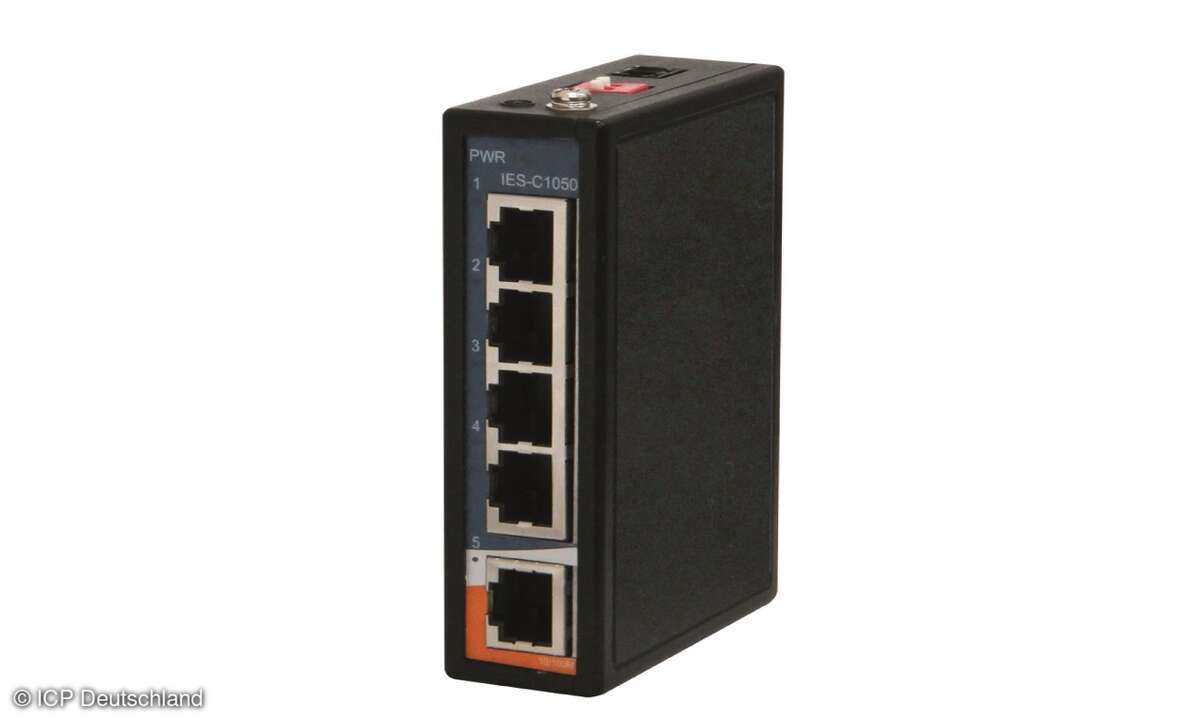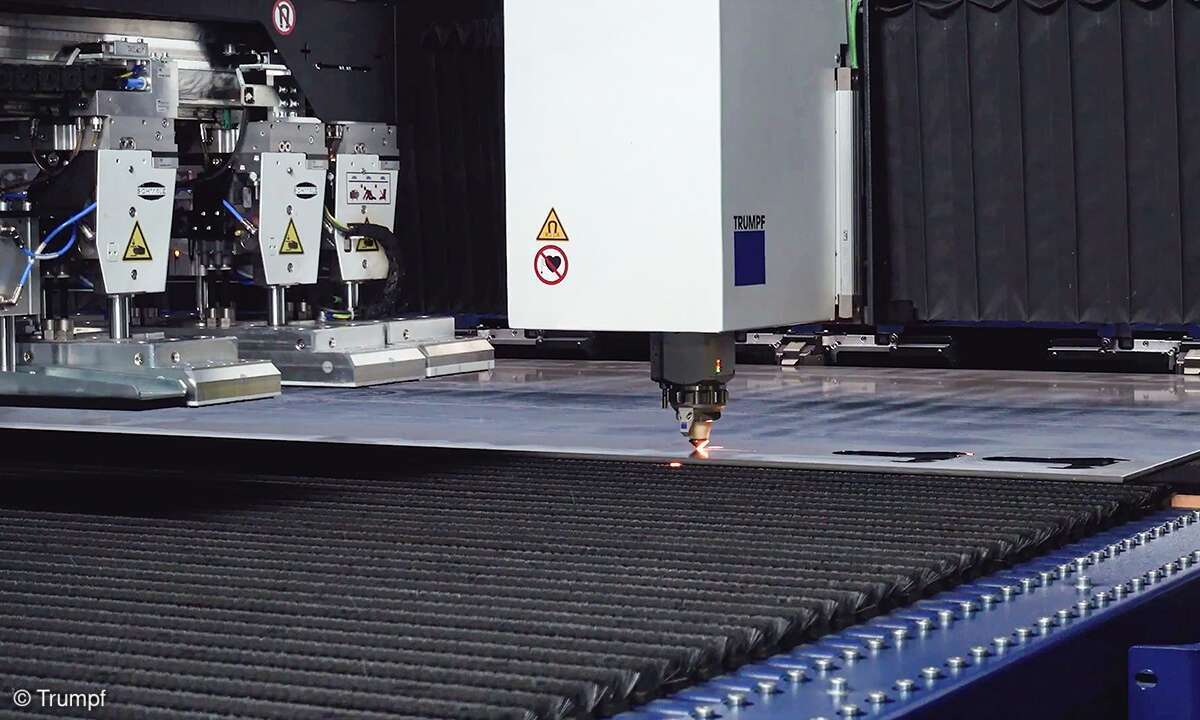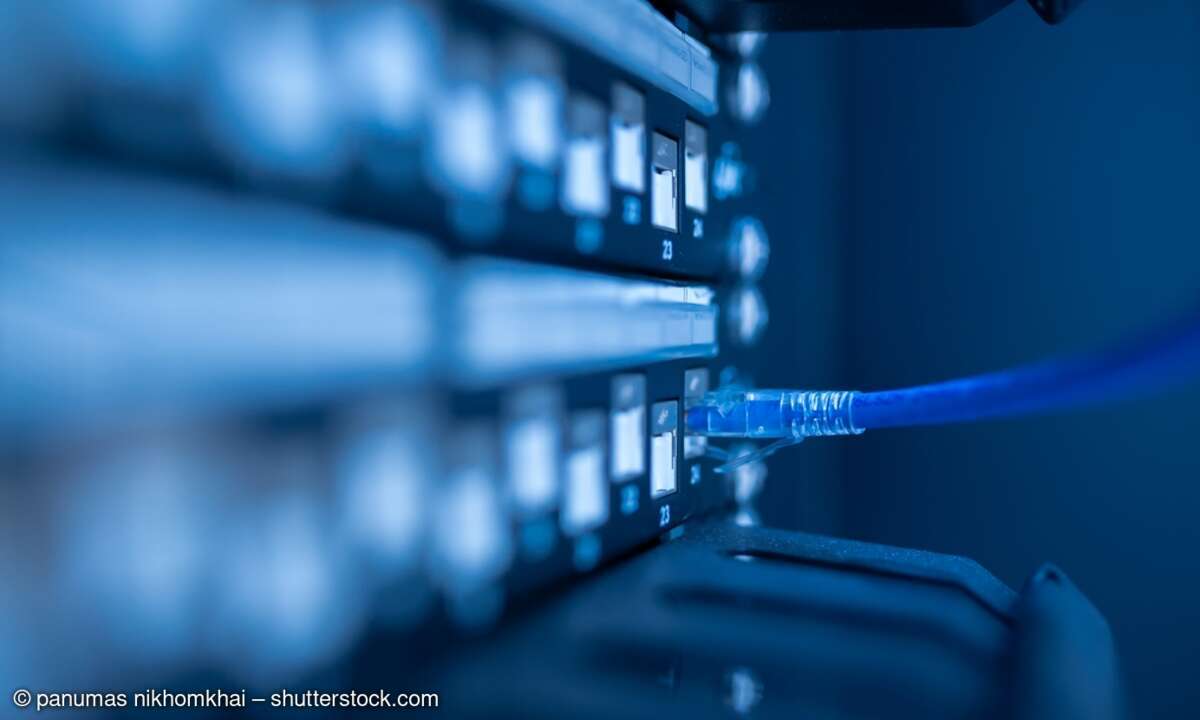Ethernet-Dienste im Auge behalten
Ethernet stellt den Anwendern überzeugende Vorteile in Aussicht und kommt heute auch zunehmend in City- und Access-Netzen zum Einsatz. Es besticht durch niedrige Installationskosten sowie eine größere und differenziertere Serviceauswahl. Doch die Bereitstellung und Überwachung von Ethernet-Diensten stellt neue Herausforderungen an das Netzwerkmanagement.
Ethernet-Services sind der neue Wachstumsmarkt in der Telekommunikation. Die Entwicklung von
reinen Datendiensten zu neuen Triple-Play-Services (Konvergenz von Daten, Sprache und Video)
verstärkt sich zunehmend. Oft realisieren Carrier diese Breitbanddienste auf der Basis bestehender
SDH- und ATM-Infrastrukturen (Synchronous Digital Hierarchy, Asynchronous Transfer Mode). Gegenüber
diesen verbindungsorientierten Techniken bietet Ethernet die Möglichkeiten einer paketorientierten
Übertragung.
Bisher hielten sich die Netzbetreiber mit der Implementierung eines großflächigen Angebots von
Ethernet-Diensten noch zurück. Die Gründe dafür lagen in den relativ hohen Anschaffungs- und
Verwaltungskosten sowie mangelnder Standardisierung. In Zusammenarbeit mit Standardisierungsgremien
wie IEEE und IETF definiert das Metro Ethernet Forum (MEF) in seinen kürzlich verabschiedeten
Standards eine klare Richtlinie für Ethernet-Dienste in Metropolitan Area Networks (Stadtnetzen)
über unterschiedliche Transporttechniken.
Vorteile des Ethernet-Einsatzes
Ethernet-basierte Dienste bringen Service-Providern wie auch Anwendern einen großen Nutzen. Denn
die Vorteile von Ethernet in Bezug auf Wartung und Inbetriebnahme stehen nun auch in Access- und
Stadtnetzen zur Verfügung. Sie bieten ein attraktives Marktsegment für Netzbetreiber, die neue
Dienste anbieten wollen. Niedrige Erstinstallations- und Betriebskosten pro Kunde sichern die
Wirtschaftlichkeit für den Dienstanbieter. Die Flexibilität und Skalierbarkeit von Ethernet
ermöglicht es ihm, Geschäftskunden profitable und differenzierte Ethernet-Dienste bereitzustellen,
so zum Beispiel Layer-2- und Layer-3-VPNs mit garantierten SLAs (Service Level Agreements,
Serviceverträgen).
Neue Übertragungseinrichtungen integrieren die Effizienz der Paketvermittlungstechnik und die
Wirtschaftlichkeit der Ethernet-Übertragung in bestehende Netzstrukturen wie Sonet/SDH. Das
Ethernet-Protokoll eignet sich nicht nur für bestehende Dienste, sondern auch für neue wie Voice
und Videoconferencing over IP sowie Video-Broadcasting. Die Endbenutzer profitieren von geringeren
Kosten und einer größeren Dienstauswahl für verschiedenste Anforderungen.
Ethernet-Services
Das MEF unterscheidet zwei Typen von Metro-Ethernet-Diensten: den Ethernet-Line- und den
Ethernet-Service (E-Line, E). Der E-Line-Service ist eine statische Verbindung (Leased Line) mit
fester Bandbreite zwischen zwei Kunden-Interfaces (Customer Premise Equipment, CPE, also
Netzabschlussgerät). Das CPE ist noch Bestandteil des Netzes, das der Provider managt. Als
Übertragungsprotokoll zwischen CPE und CLE (Customer-Located Equipment, Netzzugangsgerät) kommt
Ethernet zum Einsatz. Das Kunden-Interface heißt auch UNI (User-Network Interface).
Ein E-Line-Service basiert also auf einer klassischen Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei
Anwenderstandorten oder zwischen einem Anwenderstandort und einem Internet-Service-Provider. Ein
E-LAN-Service hingegen ermöglicht eine Multipoint-to-Multipoint-Architektur zwischen mehreren
Anwenderstandorten über dedizierte Verbindungen. Aus Anwendersicht erscheint der E-LAN-Service als
transparentes LAN.
Servicemanagement
Im Vergleich zum kanalbasierten TDM (Time Division Multiplexing) und den zellenbasierten
Techniken stellt die Einrichtung und Überwachung von Dienstgüteparametern für Ethernet-Dienste
komplexere Anforderungen an das Netzwerkmanagement. Ein OSS (Operations Support System) für die
Aktivierung von Ethernet-Services sollte deshalb auf folgenden Kernkomponenten aufbauen:
Verwaltung eines Servicekatalogs mit zugehörigen Serviceklassen und
-definitionen,
Verwaltung von Kundendaten und SLAs,
Management und Konfiguration des Netzwerkinventars,
Bereitstellung und Aktivierung von Ethernet-Services,
Überwachung und Monitoring der Dienstgüte (Quality of Service, QoS),
Systemadministration und Security-Funktionalität.
Im Servicekatalog sind die Serviceklassen (Classes of Service, CoS) und die
Performance-Parameter technikunabhängig definiert. Zu den wesentlichen Parametern eines
Ethernet-Services gemäß MEF-Definition zählen:
Performance-Parameter wie Fehlerrate (Packet Loss), Verzögerung von
Datenpaketen (Delay) und wechselnde Verzögerung (Flattern, Jitter),
Beschreibungen des Datenverkehrs wie zugesicherte und maximale
Übertragungsrate (Committed Information Rate, CIR, Constant Bit Rate, CBR, Peak Information Rate,
PIR, Peak Burst Size, PBS),
VLAN-Zugehörigkeit (Virtual LAN), festgelegt durch eine eindeutige
VLAN-Identifizierung (Tag),
Connectivity: Point-to-Point oder Multipoint-to-Multipoint.
Ein Netzbetreiber definiert einen Service anhand der Serviceparameter und zusätzlicher
betrieblicher Grenzwerte. Hierzu zählen die Verfügbarkeit eines Services, durchschnittliche
Reparaturzeiten (Mean Time to Repair, MTTR) sowie die mittlere Zeit zwischen Fehlern (Mean Time
between Failures, MTBF). Per Servicevertrag (SLA) ordnet der Netzbetreiber den Ethernet-Service
einem Kunden zu. In einer Kundendatenbank verwaltet er alle nötigen Informationen und verknüpft sie
mit den Leistungsdaten und aktiven Ressourcen des Services. Über ein Webportal erhält der Anwender
einen direkten Zugriff auf seine Servicedaten wie zum Beispiel Verfügbarkeit und Auslastung des
Dienstes.
Netzwerkverwaltung
Grundvoraussetzung für das Management großer Netze ist das automatische Erkennen aktiver
Netzkomponenten und der Topologie. Zudem sollte das Managementsystem erkanntes Equipment passend
gruppieren (nach Kunden, Regionen, Typ etc.) und in einer konfigurierbaren Ansicht darstellen
(Business-View). Ein Update-Mechanismus muss dem Operator jederzeit eine aktuelle Darstellung des
Netzwerks liefern.
Eine Service-Provisioning-Komponente sollte die Bereitstellung des Dienstes für die ausgewählten
Service-Access-Points automatisieren. Aus Sicht des Operators reduziert sich damit die
Servicebereitstellung auf eine Transaktion. Dabei muss er vom Zeitpunkt der Konfiguration bis zur
Aktivierung des Dienstes im Netz die volle Kontrolle haben und fortlaufend Informationen über den
Fortschritt der Aktion erhalten. Eine moderne Softwarearchitektur erlaubt das gleichzeitige
Aktivieren von Services im gesamten Netz. Schlägt die Aktivierung eines Dienstes fehl, muss ein
solches System über einen Rollback-Mechanismus verfügen, der es in einen sicheren Ausgangszustand
zurücksetzt. Bei der Konfiguration und Aktivierung des Services am Netzelement (NE) sollte das
System folgende Vorgehensweisen unterstützen:
Direktzugriff auf das NE über SNMP (Simple Network Management Protocol) oder
CLI (Command Line Interface),
Integration eines EMS beziehungsweise NMS (Element/Network Management System)
über eine TMF-Schnittstelle (Telemanagement Forum).
Überwachung der Servicequalität
Nach der Serviceaktivierung hat der Operator die Aufgabe, die SLA-Parameter zu überwachen und im
Fehlerfall die zuständigen Instanzen zu benachrichtigen. NE-spezifische Datenkollektoren sammeln in
periodischen Zyklen Performance-Daten, die sich mit den SLA-Parametern abgleichen lassen. Dies
erfordert mindestens die Unterstützung der folgenden Interfaces und Protokolle:
SNMP,
Protokolle zur Flussmessung bei Ende-zu-Ende-Verbindungen Sflow (RFC 3176) und
Netflow (Cisco),
standardisiertes Interface (TMF 814a) zwischen zwei OSSs.
Bei einer Grenzwertüberschreitung sollte das Managementsystem den Operator umgehend informieren
und eine Nachricht an das übergeordnete Fault-Management- oder Trouble-Ticket-System weiterleiten.
Eine Reporting- und Monitoring-Funktionalität ermöglicht es dem Operator, Störungen frühzeitig zu
erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dabei sollte er auf Ersatzwege umschalten oder zuständige
Techniker informieren können. Eine konfigurierbare automatische Alarmweiterleitung erreicht den
Techniker auch per E-Mail oder SMS. Während des Betriebs sollte der Administrator die Auslastung
der laufenden Prozesse sowie die angemeldeten Benutzer stets im Blick haben.
Die Anforderungen an ein integriertes Servicemanagementsystem zur Aktivierung und zum Monitoring
von Ethernet-Services sind vielschichtig. Ein solches System muss eine flexible Generierung von
Serviceklassen und SLAs bieten, ebenso eine automatisierte Aktivierung der Dienste. Erst dies
sichert deren Qualität nachhaltig.