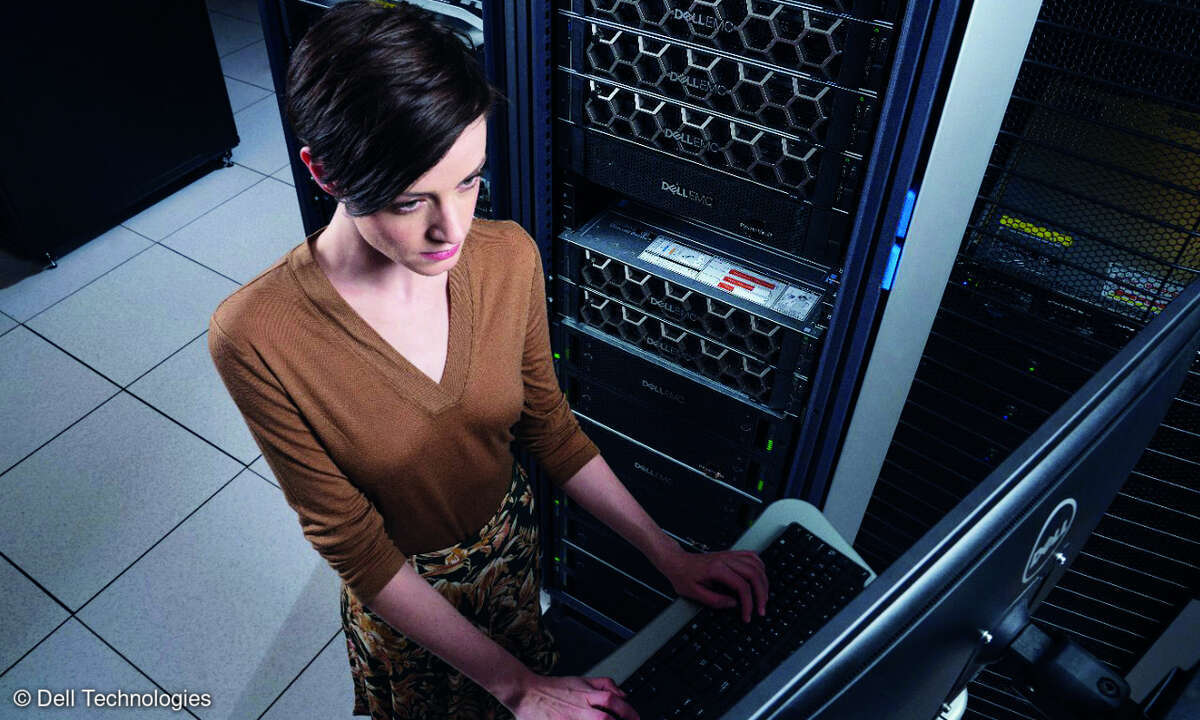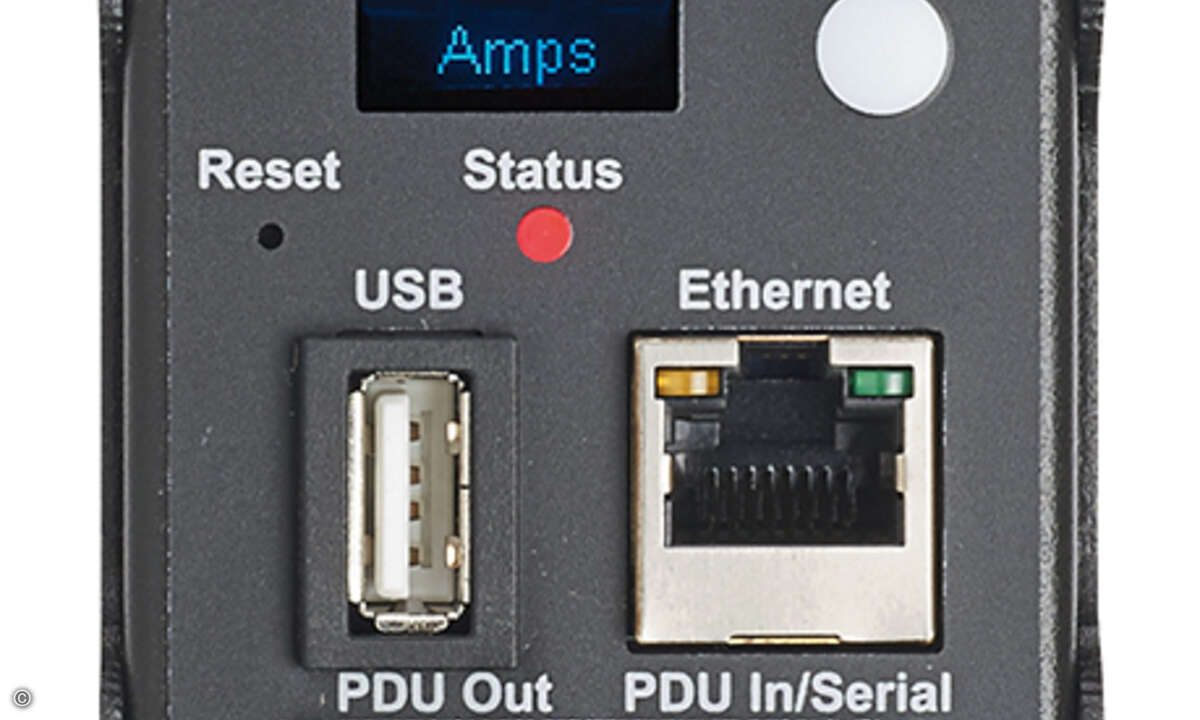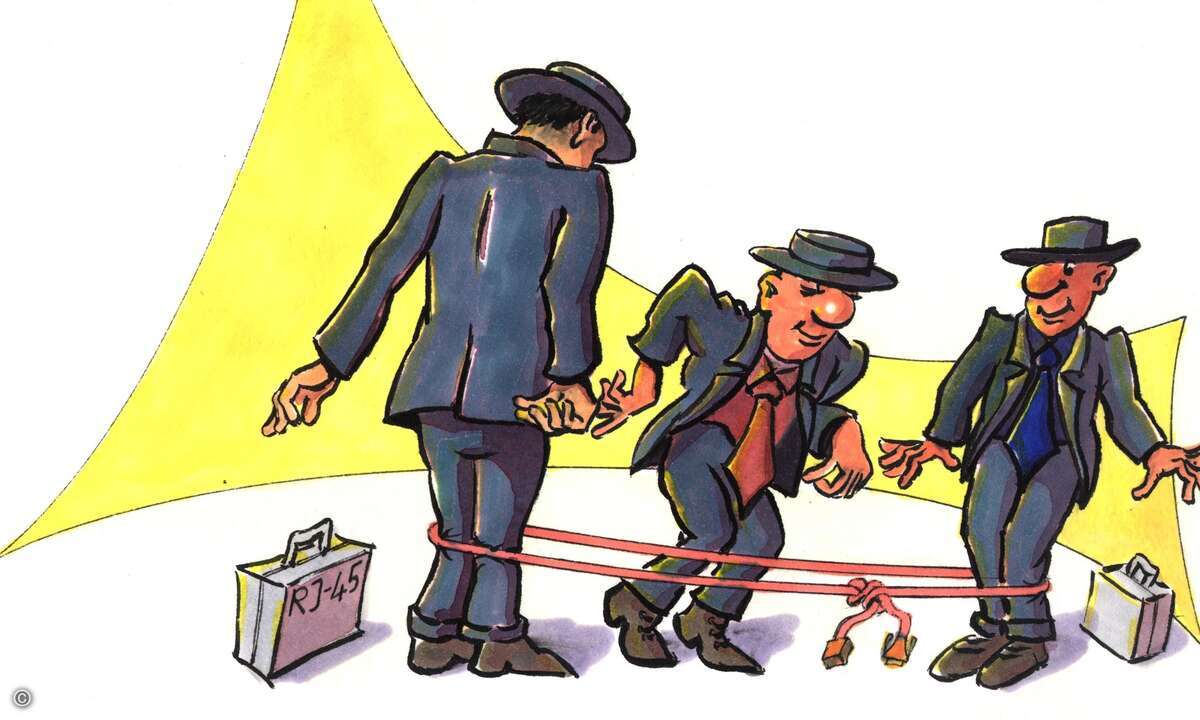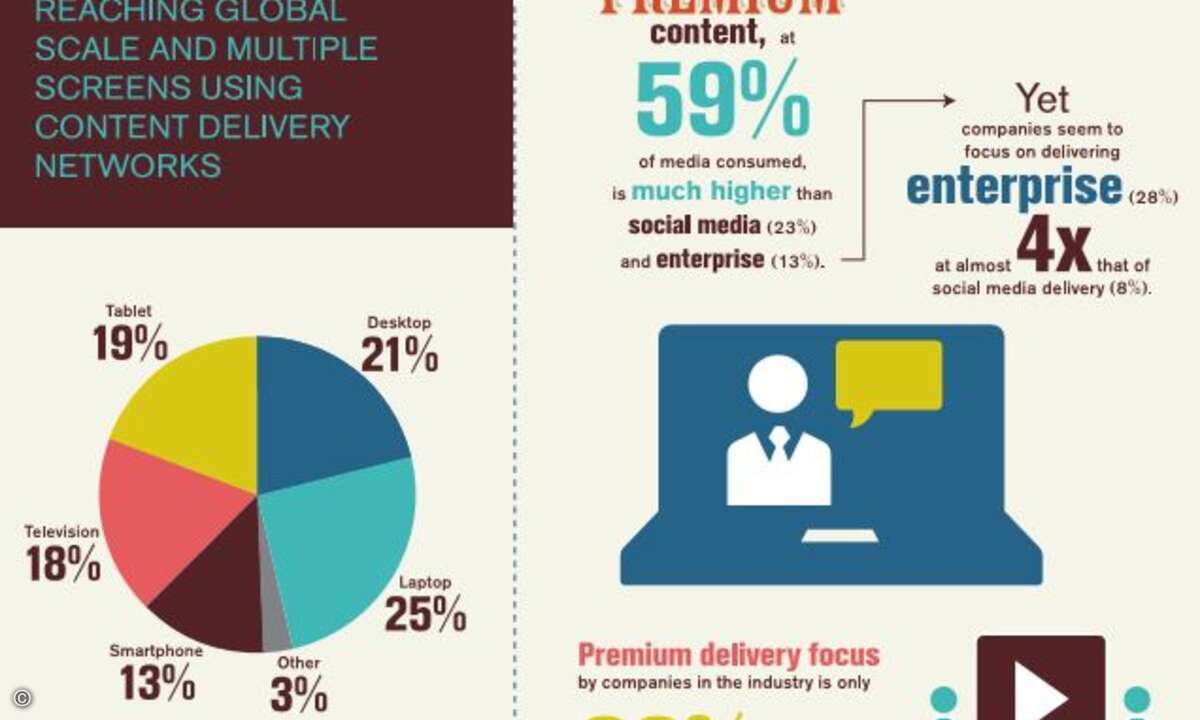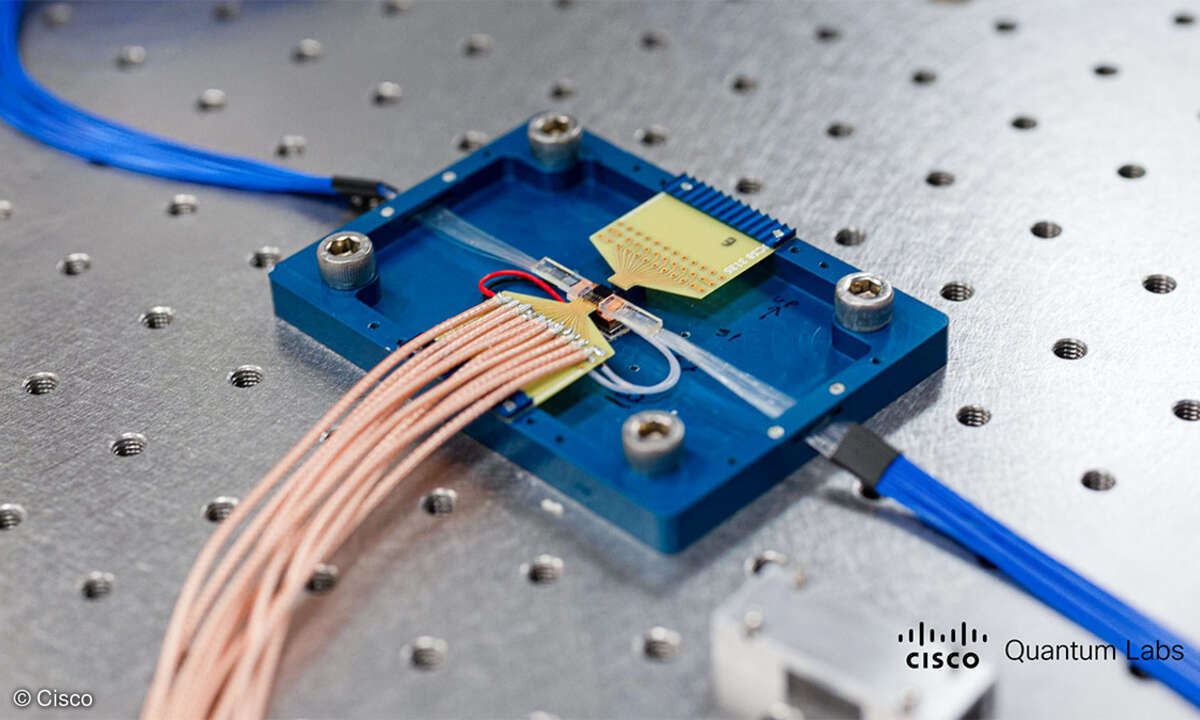Ausfallsicherheit für geschäftskritische Anwendungen
Verfügbarkeit nach Bedarf
Lange Zeit war eine hochverfügbare IT-Infrastruktur hauptsächlich in Umgebungen gefragt, in denen ein Systemausfall extrem hohe Kosten nach sich zieht, beispielweise im Banken- und Börsenumfeld oder bei Energieversorgern. Mittlerweile hat in diesem Bereich jedoch ein deutlicher Wandel stattgefunden: Die zunehmende Abhängigkeit der Unternehmen von funktionstüchtiger IT erfordert bei immer mehr Applikationen hohe und höchste Verfügbarkeit. Umso wichtiger sind für Unternehmen eine klare Definition der jeweiligen Verfügbarkeitsanforderungen und eine Zuordnung zu den passenden Lösungsansätzen.

In der modernen Geschäftswelt entwickelt sich hohe Verfügbarkeit von IT-Systemen mehr und mehr zum unverzichtbaren Muss. Mit der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsabläufen und den dazugehörigen Daten setzen heute bereits kleine und mittelständische Unternehmen die Anwendungs- und Datenverfügbarkeit an die erste Stelle ihrer Prioritätenliste. Bei einem Ausfall unternehmenskritischer Systeme bewegt sich der Umsatzverlust laut unterschiedlichen Studien bei mittelgroßen Unternehmen je nach Branche zwischen 45.000 und einer Million Euro pro Stunde. Untersuchungen zur Ausfallzeit bei Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern ergaben einen durchschnittlichen Verlust von etwa 275.000 Euro pro Jahr.
Um einen durchgehend reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleisten zu können, sind folglich zunehmend mehr IT-Systeme und Applikationen vor so genannter ungeplanter Downtime zu schützen, was auch wesentlich höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit stellt als früher. Genau dieses Phänomen erschwert es Geschäftsführern und IT-Leitern aber, die jeweils passende Lösung am Markt ausfindig zu machen.
Verfügbarkeit auf unterschiedlichen Niveaus
Eine allgemeine Definition von „Hochverfügbarkeit“ ergibt sich aus der Anforderung, dass eine geschäftskritische Applikation auch im Fehlerfall weiterhin verfügbar bleiben muss – und dies mit der kleinstmöglichen Unterbrechung sowie ohne großen administrativen Aufwand. In einem ersten Schritt gilt es daher für Unternehmen, zu bewerten, welche Anwendung – je nach Wichtigkeit – welchen Grad an Verfügbarkeit benötigt. Schließlich reichen die am Markt angebotenen Lösungsansätze von einfachen Backup- und Recovery-Szenarien über hochverfügbare Systeme bis hin zu Installationen, die eine absolut kontinuierliche Verfügbarkeit und vollständige Ausfallsicherheit bieten können. Je geschäftskritischer ein System ist, desto höher sind die Anforderungen an den Verfügbarkeitsgrad. Bei der Entscheidungsfindung erscheint es daher überaus wichtig, zu verstehen, dass Hochverfügbarkeit nicht gleich Hochverfügbarkeit ist. Im nächsten Schritt gilt es, eine individuelle, an die Anforderungen des Unternehmens angepasste Definition von Verfügbarkeit festzulegen, um letztendlich die bestmögliche Lösung zu finden.
Relevante Fragestellungen für eine zielführende Bewertung
In vielen Fällen stellt sich für Unternehmen das größte Problem bereits zu Beginn eines Projekts: „Welche Systeme gelten als geschäftskritisch, und wie viel kostet eine Unterbrechung oder ein Ausfall dieser Systeme?“ Ein großer Teil kleiner und mittelständischer Unternehmen hat bereits mit der Beantwortung dieser Frage große Schwierigkeiten, oder ist gar nicht in der Lage, dazu eine detaillierte Aussage zu formulieren. Unumgänglich ist dazu vorab eine sehr genaue Betrachtung der eigenen IT-Umgebung sowie der vorhandenen Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse. Dabei stellt sich zuallererst die Frage, welcher Ausfall welche Anwendung betrifft. Entstehen dadurch direkte Einnahmeverluste, oder kommt es zu Produktionsausfällen? Wie hoch sind in den betroffenen Bereichen die Kosten für Personal und Räumlichkeiten? Wie lange kann und – vor allem – darf in den einzelnen Umfeldern ein Ausfall andauern, und hat das Unternehmen durch einen solchen Ausfall mit dem Verlust geschäftskritischer Daten zu rechnen? Dies stellt allerdings nur einen Bruchteil der relevanten Fragestellungen dar, die in Hochverfügbarkeitsprojekten zum Tragen kommen, was aber zugleich die Komplexität des Themas verdeutlicht. Die Bewertung und Einordung der Relevanz einzelner Systeme und Anwendungen stellt einen der Kernpunkte dar. Früher waren es in erster Linie ganz spezielle Applikationen, die als besonders kritisch einzustufen waren – wie zum Beispiel Trading-Systeme im Börsenumfeld, automatische Hochregalsysteme, Notruf-, Kraftwerks- und Produktionsleitwarten oder Gebäudesicherheits- und Zugangskontrollsysteme. Heute haben aber zunehmend auch klassische Infrastrukturanwendungen wie Microsoft Exchange und Sharepoint, SQL-Datenbanken, Messaging-Systeme oder Unified-Communications-Plattformen geschäftskritischen Charakter, weil CRM- und Vertriebssysteme dort andocken. Einen zusätzlichen, deutlichen Wandel im Markt hat es durch das Thema Virtualisierung gegeben. Server-, Storage- und Desktop-Virtualisierung sind mittlerweile fester Bestandteil der IT-Umgebung in Unternehmen jeder Größenordnung mit steigender Tendenz. War noch vor einigen Jahren der Anteil wirklich unternehmenskritischer Systeme sehr gering, ist dieser Prozentsatz im Lauf der Zeit dadurch deutlich angestiegen, da jetzt der Ausfall eines einzelnen Systems, auf dem vielfältige virtuelle Applikationen oder Dienste laufen, wesentlich weitreichendere Folgen haben kann.
Die Verfügbarkeitspyramide
Eine generelle Zuordnung spezifischer Applikationen zu festen Verfügbarkeitsniveaus ist heute kaum noch möglich, da nicht jedes Unternehmen die Frage nach der Wichtigkeit der einzelnen Systeme in gleicher Weise beantworten wird. Was für ein Vertriebsunternehmen das Warenwirtschaftssystem mit der entsprechenden Datenbank bedeutet, nämlich die geschäftskritische Anwendung Nummer eins, stellt für eine Callcenter-Agentur möglicherweise die VoIP-TK-Anlage dar. Eine Einteilung der unterschiedlichen Lösungsansätze in Verfügbarkeitsstufen ist aber dennoch möglich – und letztendlich auch wichtig bei dem individuellen Entscheidungsprozess, für welches System welche Lösung auszuwählen ist.
Einfache Backup- und Recovery-Produkte sind bei solch einer Klassifizierung eher im unteren und mittleren Bereich einer „Verfügbarkeitspyramide“ anzusiedeln, ebenso wie asynchrone Replikationslösungen. Vor allem deshalb, weil dabei üblicherweise der manuelle Aufwand noch recht hoch ist, und nicht zuletzt aus diesem Grund eine relativ lange Downtime für die betroffenen Systeme im Fehlerfall resultiert. Wesentlich geringer fällt die Downtime bei Lösungen aus, die mit synchroner Datenspiegelung sowie automatisierten Failover- und Recovery–Szenarien arbeiten. An der Spitze der Pyramide stehen fehlertolerante Systeme, die einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten und auf Fehler reagieren, bevor diese zu einem Ausfall führen.
Der Komplexität Herr werden
Um in diesem Umfeld für jede Anwenderanforderung den passenden Lösungsansatz bieten zu können hat beispielsweise der Value Added Distributor ADN in den letzten Jahren ein entsprechendes, umfangreiches Portfolio sowie Know-how zum Thema Hochverfügbarkeit aufgebaut. Der Blick auf einige Beispiellösungen beginnt mit dem unteren und mittleren Bereich der Verfügbarkeitspyramide: Server und Applikationen die über geringere Anforderungen an den Verfügbarkeitsgrad verfügen, und bei denen eine gewisse Downtime sowie eine manuelle Wiederherstellung akzeptabel sind, lassen sich recht kostengünstig und effizient mit einer Backup- und Recovery-Lösung schützen. Der Hersteller Acronis etwa, bekannt durch seine Disk-Imaging- und Bare-Metal-Restore-Techniken (siehe LANline 12/2011), bietet mit dem aktuellen Produkt „Backup and Recovery 11“ die Möglichkeit, physische und virtuelle Server zu sichern und im Fehlerfall eine zeitnahe Wiederherstellung des gesamten Systems oder auch einzelner Dateien zu gewährleisten.
Sieht sich ein Unternehmen mit höheren Anforderungen an die Storage-Infrastruktur konfrontiert, beispielsweise durch Server- und Desktop-Virtualisierungsprojekte, rückt zwangsläufig auch die Anschaffung von Shared-Storage-Systemen in den Fokus. Dies bringt neben weiteren Kosten auch zusätzliche Komplexität in das Thema „Verfügbarkeit der IT-Umgebung“. Nicht zuletzt wegen der vollständigen Hardwareunabhängigkeit und der hohen Skalierbarkeit lohnt sich in diesem Umfeld durchaus ein näherer Blick auf den Ansatz der Storage-Virtualisierung. Viele Anwender vertrauen bereits auf diese Technik, um ihre Daten zu sichern und über asynchrone oder – im Idealfall – vollsynchrone Datenspiegelung Ausfallrisiken zu minimieren und die Verfügbarkeit durch automatisierte Failover-Mechanismen deutlich zu erhöhen. Datacore beispielsweise gehört in diesem Segment mit seiner softwarebasierenden Lösung Sansymphony-V (siehe LANline 10/2011) zu den wichtigen Playern der Branche.
An der Spitze der Verfügbarkeitspyramide, dem Bereich fehlertoleranter Systeme mit einer Verfügbarkeit von 99,999 Prozent, waren bis vor einigen Jahren lediglich stark hardwarebasierende und überaus hochpreisige Lösungen zu finden. Auch dort gibt es mittlerweile softwarebasierende Produkte, die nicht nur hardwareunabhängig, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sind und somit einem wesentlich größeren Anwender- und Applikationskreis zur Verfügung stehen. Der Hersteller Marathon Technologies etwa gilt als Spezialist für Systeme mit höchsten Anforderungen an Ausfallsicherheit und kontinuierlichen Geschäftsbetrieb. Sein aktuelles Flaggschiff Everrun MX beispielsweise garantiert Fehlertoleranz für beliebige Windows-Applikationen auf Standardhardware – und dies ohne den Einsatz externer Storage-Komponenten, was durchaus als Besonderheit gelten kann.
Dies sind selbstverständlich nur einige Beispiele eines sehr umfangreichen Markts, dem aufgrund ständig wachsender Anforderungen an IT-Umgebungen und deren Verfügbarkeit ein immer größerer Stellenwert zukommt. Denn in Zeiten von durchgängiger Internet-Präsenz, Web-Shops und Cloud Computing wollen Mitarbeiter und Kunden möglichst zu jeder Zeit und von überall auf Daten, Anwendungen und Informationen zugreifen können.

Storage-Virtualisierung eröffnet einen interessanten Weg zu höherer Verfügbarkeit - hier am Beispiel von Datacore Sansymphony V. Bild: Datacore

Die Verfügbarkeitspyramide präsentiert die Hierarchie unterschiedlicher Verfügbarkeitsstufen - von ungeschützten Systemen bis zur Hochverfügbarkeit. Bild: IDC, Marathon
Anzeige