Mit Kurzarbeit durch die Talsohle
Kurzarbeit als Rettungsring in krisengeschüttelten Zeiten. Rund 700.000 Menschen arbeiten in Deutschland kurz. Monat für Monat werden es mehr. Vorteil für die Beschäftigten: Sie werden nicht entlassen. Vorteil für die Unternehmen: Sie sparen Lohn- und Nebenkosten, können bei besserer Wirtschaftslage sofort mit erfahrenem Personal wieder durchstarten.
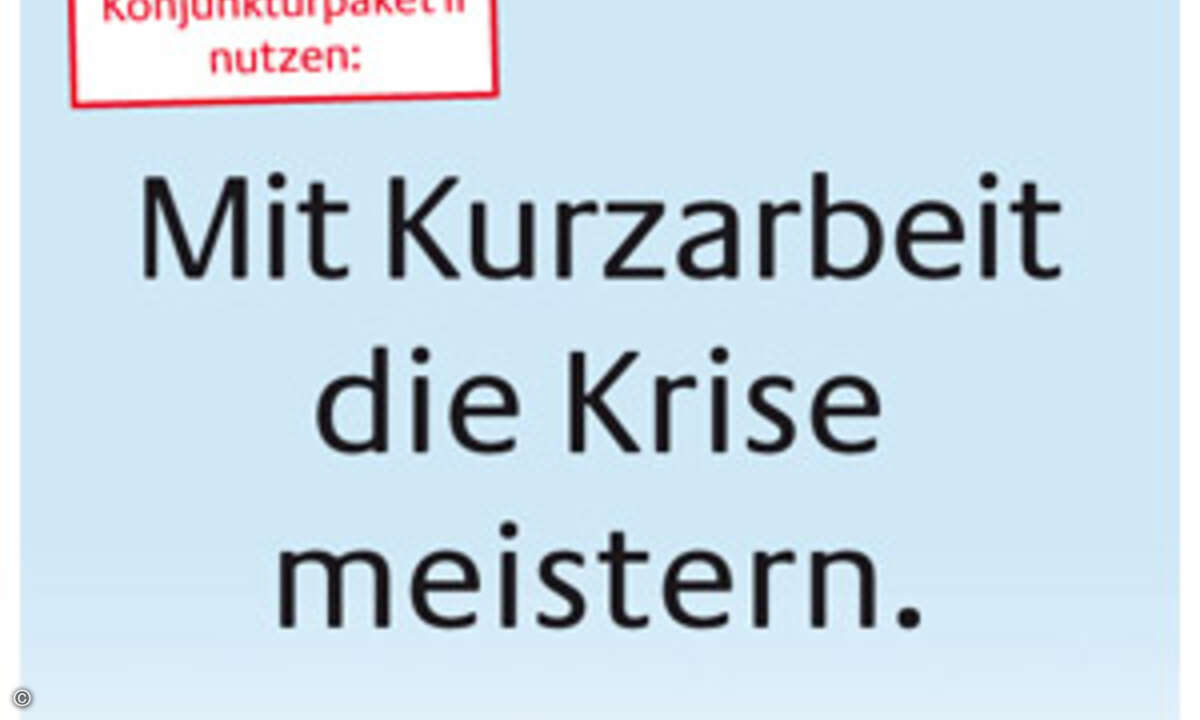
Selten sind sich Arbeitsminister, Gewerkschaften und Arbeitgeber so einig, wie beim »Erfolgsrezept« Kurzarbeit. Spricht Arbeitsminister Olaf Scholz von »mit Kurzarbeit die Krise meistern«, nicken DGB-Chef Michael Sommer und Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt wohlwollend. Für Hundt bietet Kurzarbeit die Möglichkeit, dass seine Kollegen bei nachlassender Auftragslage den Betrieb herunterfahren und dabei Lohnkosten und Sozialabgaben sparen können. Sommer wiederum versteht das Instrument Kurzarbeit als Rettungsring vor der Arbeitslosigkeit. Sicher ist, die Konjunkturpakete der Bundesregierung machten Kurzarbeit attraktiv. So attraktiv, dass mittlerweile rund 700.000 Beschäftigte in Deutschland kurz arbeiten. Tendenz steigend. Allein der Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie meldet, dass sich »62 Prozent der Firmen im ZVEI derzeit der Kurzarbeit bedienen«. Auch die viele Jahre verwöhnte ITK-Wirtschaft setzt Kurzarbeit verstärkt als Überbrückungshilfe in der konjunkturschwachen Phase ein – Hersteller wie Distributoren gleichermaßen.
Über Kurzarbeit werden bereits seit knapp 100 Jahren auftragsschwache Phasen abgefedert. Am 25. Mai 1910 wurde der erste Vorläufer des Kurzarbeitergeldes, das Kali-Gesetz erlassen. Mit diesem Gesetz wurde die Kapazität der Kali-Industrie abgebaut. Die Arbeiter erhielten eine vom Deutschen Reich bezahlte Kurzarbeiterfürsorge. Die heutige Form des Kurzarbeitergeldes entstand 17 Jahre später mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.









