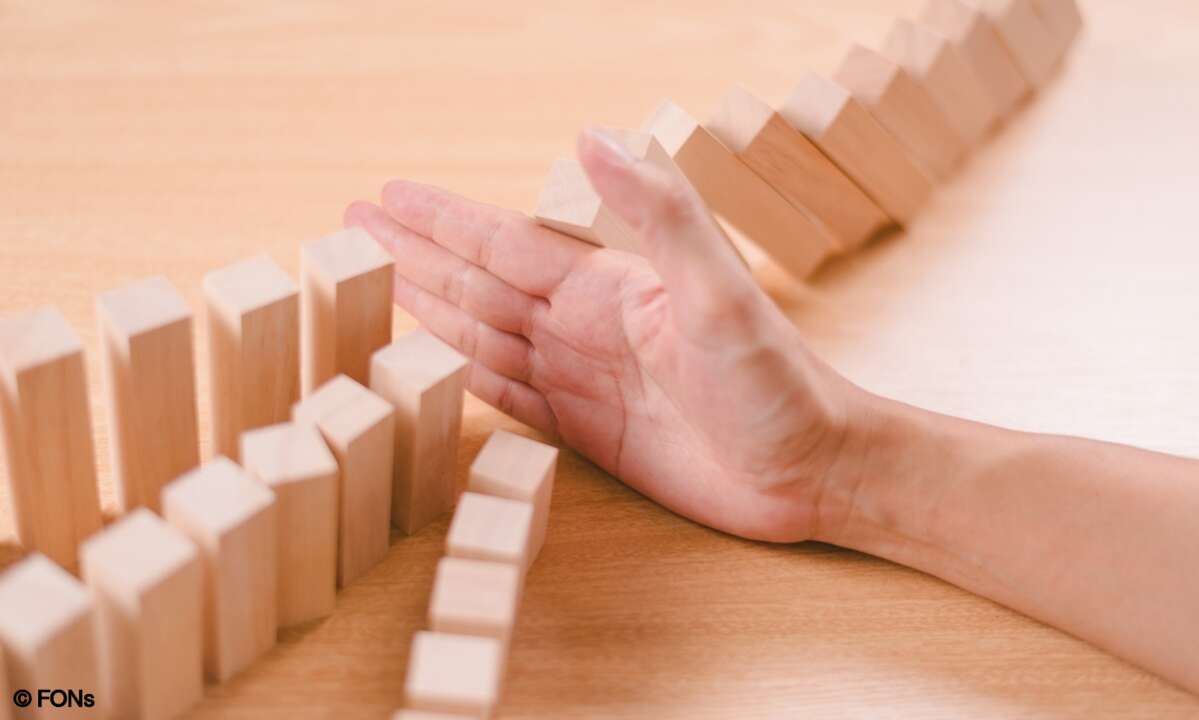»Das Modell bietet eine gemeinsame Sprachbasis«
»Das Modell bietet eine gemeinsame Sprachbasis« CIO Klaus Vitt gibt im Gespräch mit Michael Erben* Einblick in strategische Zusammenhänge der UML-Modellierung von Anforderungen und Prozessen bei der Bundesagentur für Arbeit.

Herr Vitt, in Form einer Modellierung gewinnen Sie Zug um Zug eine umfassende Sicht auf die Geschäftsprozesse Ihres Hauses. Ist das Ziel hier, eine Dokumentation zu erhalten, oder verfolgen Sie einen weiter reichenden Ansatz? Die Modellierung dient nicht nur der Dokumentation, sondern zielt darauf ab, ein besseres Verständnis und einen besseren Überblick über die Geschäftsprozesse zu erhalten, um auf der Grundlage der durch die Modell-Sichtweise gewonnenen Transparenz Optimierungspotenziale aufdecken zu können. Das Geschäftsprozessmanagement soll die Anforderungen an die IT-Verfahren mit den operativen Aktivitäten verbinden.
Mit einer modellgetriebenen Vorgehensweise haben Sie IT-intern bereits gute Erfahrungen gemacht, namentlich bei der Entwicklung der Software zur Abrechnung des Arbeitslosengeldes 1. Welchen Stellenwert hat bei der BA das erstellte Geschäftsprozessmodell neben den Erfordernissen einer systematischen Dokumentation der Prozesse? Neben der erwähnten Transparenz bietet das Geschäftsprozessmodell vor allem auch eine gemeinsame systematisierte Sprachbasis zwischen dem Fachbereich und der IT sowie für neue Mitarbeiter die Möglichkeit, sich schneller und einfacher mit den Geschäftsprozessen vertraut zu machen. Die durchgängige Darstellung, zum Beispiel welche Maske eines IT-Verfahrens bei den Aktivitäten einer Fallbearbeitung aufgerufen wird, ermöglicht die ergonomische und harmonische Gestaltung von IT-Verfahren und Arbeitsabläufen.
Haben Sie Erfahrungen mit dem Modellierungsansatz für die Geschäftsprozesse gemacht, die Ihren CIO-Kollegen auf Bundes- und Länderebene von Nutzen sein können? Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich würde empfehlen, sich am Anfang auf die Kernprozesse zu konzentrieren. Ferner halte ich die Unterstützung des Top-Managements für unerlässlich, da es sich hierbei um eine strategische Unternehmensentscheidung handelt. Neben dem Aufwand für die erstmalige Prozessmodellierung kostet die Pflege und Aktualisierung des Geschäftsprozessmodells einen konstanten und hohen personellen Aufwand.
Gibt es auf dem von Ihnen eingeschlagenen Weg Elemente, die Grundlage signifikanter Verbesserungen sind und als erste in Angriff genommen werden sollten? Ich würde vorschlagen, mit den wesentlichen Geschäftsprozessen zu beginnen, dann die bestehende IT-Anwendungslandschaft dazu zu spiegeln und daraus festzustellen, wo die größten Handlungsbedarfe bestehen.
Sie unternehmen außerdem beträchtliche Anstrengungen, Ihre IT-Anwendungen im Sinn einer serviceorientierten Architektur umzubauen. Wo befinden Sie sich augenblicklich auf Ihrer Roadmap? Wir sind hier in mehreren Projekten und Aktivitäten unterwegs. Mit der allgemeinen Terminverwaltung gehen wir mit einem neuen Basisdienst in diesem Quartal produktiv. Dieser erlaubt uns, sämtliche Terminierungsfunktionalitäten aus unseren Anwendungen herauszunehmen und damit die Komplexität deutlich zu reduzieren. Weiter gehen wir Themen wie rollenbasierte Oberflächen oder die unternehmensweite Einführung eines Enterprise Service Bus an, um die Umsetzung unserer IT-Strategie 2010 zu unterstützen.
Mit welchen Konsequenzen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung rechnen Sie beim Mapping der IT-Verfahren auf die fachliche Architektur? Hier würde ich folgende vier wesentliche Konsequenzen nennen: Wirtschaftlichkeit im Sinn eines Kosten-Nutzen-Maximums, Homogenität durch minimale Medienbrüche in den Geschäftsprozessen, Vollständigkeit bei der IT-Unterstützung und nicht zuletzt Flexibilität bei der Abdeckung sich ändernder fachlicher Anforderungen.
Michael Erben ist Journalist in Eppstein