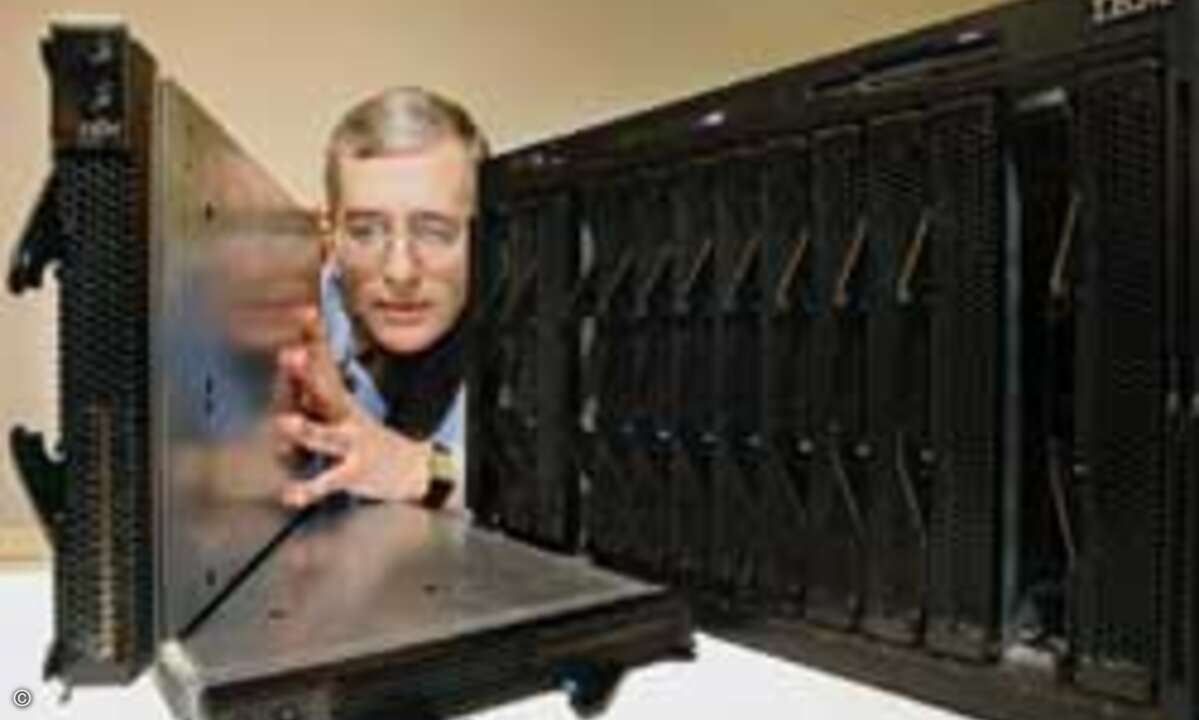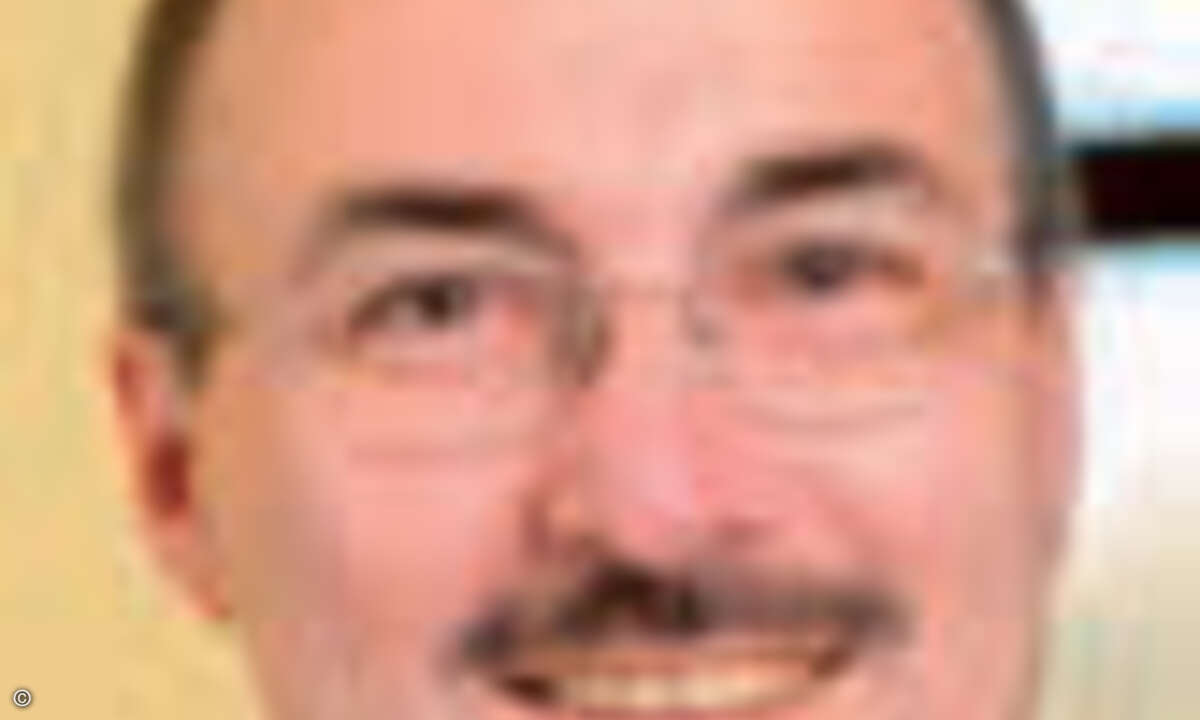Austausch im laufenden Betrieb
- Data-Center-Praxis: Mit Blades springen die Kosten über die Klinge
- Nur einmal verkabeln
- Austausch im laufenden Betrieb


Zudem werden die Ausfallzeiten durch Wartungsarbeiten kürzer oder entfallen ganz, weil sich viele Blade-Server im laufenden Betrieb einfügen oder austauschen lassen. Im Zusammenspiel mit der Virtualisierung, die das einfache Verlagern von virtuellen Systemen auf andere Hardware ermöglicht, profitieren Unternehmen dadurch von einer hohen Ausfallsicherheit ihrer IT.
Die Netzwerkkomponenten in einem Blade-Enclosure: Der Anwender hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Techniken, von GBit- und 10-GBit-Ethernet über Fibre-Channel bis hin zu iSCSI.
Ein Schwachpunkt bei der Administration virtualisierter Infrastrukturen sind häufig die Netzwerkverbindungen. So benötigt beispielsweise ein typischer Server, auf dem eine virtuelle Maschine läuft, im Schnitt sechs Netzwerkverbindungen. Diese wiederum erfordern dein Einsatz zusätzlicher Switches und Kabel (Quelle: Network Best Practices for Vmware ESX Server). Das treibt einerseits die Netzwerkkosten nach oben und führt andererseits zu einem langsameren Netzwerk.
Für Blade-basierte Infrastrukturen ist mittlerweile Abhilfe erhältlich: Mit Lösungen wie »HP Virtual Connect Flex-10« stehen Techniken zur Verfügung, die es ermöglichen, im 10-GBit/s-Ethernet-Netzwerk die Bandbreite eines einzelnen Server-Netzwerk-Ports auf vier Netzwerkverbindungen aufzuteilen.
Dadurch können den Applikationen, die auf den virtuellen Servern laufen, Bandbreiten zwischen 100 MBit/s und 10 GBit/s zugewiesen werden. Für Unternehmen hat dies den Vorteil, dass sie in ihrem Netzwerk mehr virtuelle Server einsetzen könne, und zwar ohne vorhandene Netzwerkkomponenten austauschen oder weitere hinzufügen zu müssen.
Lohnen sich Blades also nur in großen, virtualisierten Umgebungen? Nein, auch bei kleinen Unternehmen, die lediglich über wenige Server verfügen, sind Blades häufig die erste Wahl. Denn mit kompakten Enclosures, die in der Regel bis zu acht Server- und Speichersystemen Platz bieten, können Administratoren auf kleinem Raum komplette Infrastrukturen für KMUs realisieren.
Einige Enclosure-Modelle erlauben dabei den Stand-alone-Betrieb ohne Rack und sind für Umgebungstemperaturen bis über 30 Grad ausgelegt. Kleinen Betrieben bleiben dadurch Investitionen in Platz fressende Racks oder teure Kühlungs- und Klimatisierungssysteme erspart.
Apropos Kühlung: Da jeweils mehrere Blades auf gemeinsame Systeme für die Energieversorgung zugreifen, sind wesentlich weniger Netzteile notwendig. Dies sorgt nicht nur aufgrund der geringeren Anzahl von Komponenten für niedrigere Kosten, sondern durch die höhere Energieeffizienz auch für einen reduzierten Stromverbrauch und weniger Abwärme im Vergleich zu herkömmlichen Servern.
So benötigen moderne Blades rund 30 bis 40 Prozent weniger Strom als vergleichbar konfigurierte Rack-Server. Daraus resultieren bei gleicher Rechenleistung geringere Anforderungen an die Klimatisierung des Serverraums.
Auch bei größeren Unternehmen kommen Vorzüge wie niedriger Energieverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität sowie eine kostengünstige Administration zum Tragen. Zudem wächst die Vielfalt angebotener Server-Modelle: Diese reicht von ultrakompakten Systemen, bei denen zwei Server in einen Enclosure-Einschub passen, bis hin zu hochverfügbaren Blades (»Nonstop-Systemen«).
Hinzu kommen Modelle, die für spezielle Einsatzgebiete konzipiert und zertifiziert sind, etwa für die Infrastrukturen von Telekommunikationsanbietern. Selbst beim High-Performance-Computing (HPC) bestehen die meisten neuen Systeme aus Blade-Servern und ersetzen dort proprietäre Systeme und Mainframes.
Seit einigen Monaten sind auch erste Blade-Server verfügbar, die speziell auf die Anforderungen virtualisierter Umgebungen zugeschnitten sind. Diese verfügen über besonders viel Arbeitsspeicher. Denn als typische Konfiguration gelten 4 GByte RAM pro virtuelle Maschine, was selbst bei kleineren Servern über 100 GByte Arbeitsspeicher erforderlich machen kann, um einen leistungsfähigen Betrieb zu gewährleisten.
Als Netzwerk-Standard kommt verstärkt 10-Gbit-Ethernet zum Einsatz, weil die Images der Server in der Regel auf externen Speichersystemen liegen. Im Gegenzug sinken die Anforderungen an die internen (Platten-)Speicher; sie werden häufig sogar komplett überflüssig.
Diese Entwicklungen sorgen für den Durchbruch des Formfaktors Blade bei unterschiedlichen Einsatzszenarien in Betrieben aller Größenordnungen. »Blades haben sich zu einer ausgereiften Technologie entwickelt«, fasst Thomas Meyer, Vice President of Systems Research bei der Marktforschungs- und Beratungsfirma IDC zusammen. »Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, einfache Verwaltung und eine verbesserte »Total-Cost-of-Ownership« (TCO) sind für Unternehmen die vier Hauptgründe, in Blade-Server zu investieren.«
Der Formfaktor Blade ist auch bei den Clients auf dem Vormarsch: Mit Blade-PCs und Blade-Workstations lassen sich zentralisierte Infrastrukturen realisieren, die einfach und kostengünstig zu verwalten sind. Anwender greifen über klassische oder mobile Thin-Clients darauf zu.
Alternative zu Desktop-Rechnern: Blade-Workstations wie die HP Proliant xw 460c werden zentral im Data-Center installiert. Der Nutzer greift auf die Anwendungen und Daten auf den Systemen über einen Thin-Client zu.
Auch in Sachen Sicherheit zahlt sich ein solches Konzept aus: Da die eigentlichen Daten im Serverraum oder Rechenzentrum bleiben und lediglich verschlüsselte Bildschirminhalte an die Endgeräte übermittelt werden, ist eine maximale Sicherheit gewährleistet.
Zum Autor: Carsten Unnerstall ist Business Manager HP Blade System bei der Hewlett-Packard GmbH.