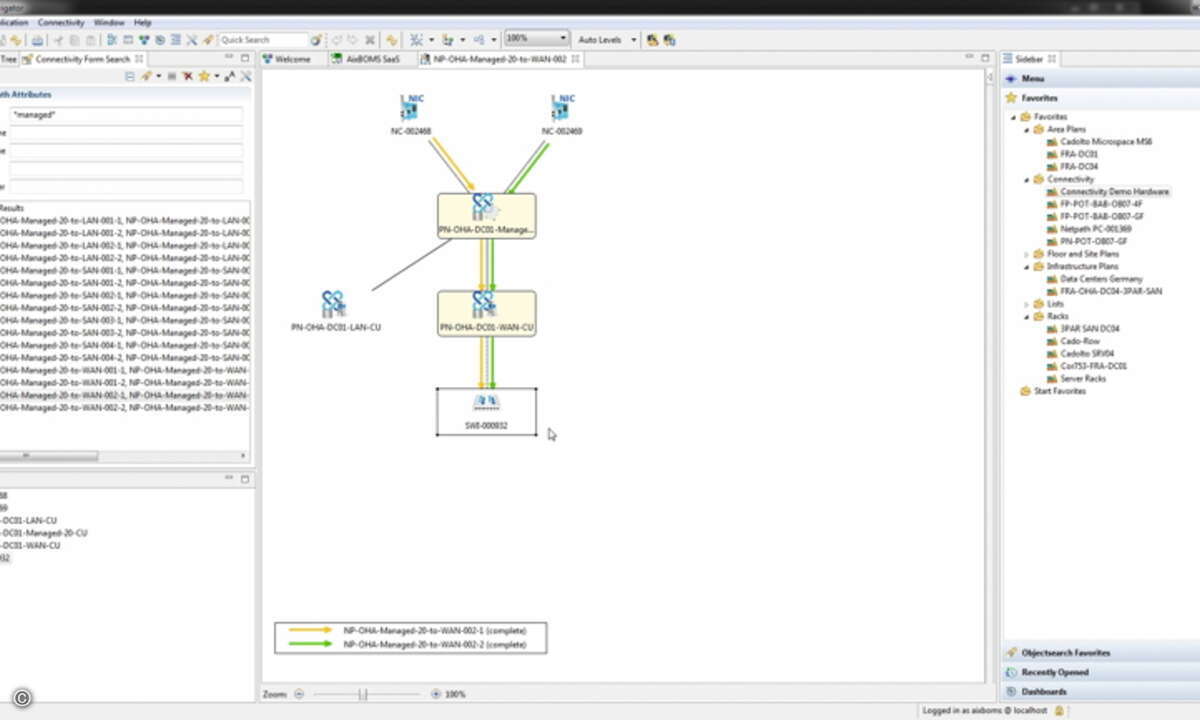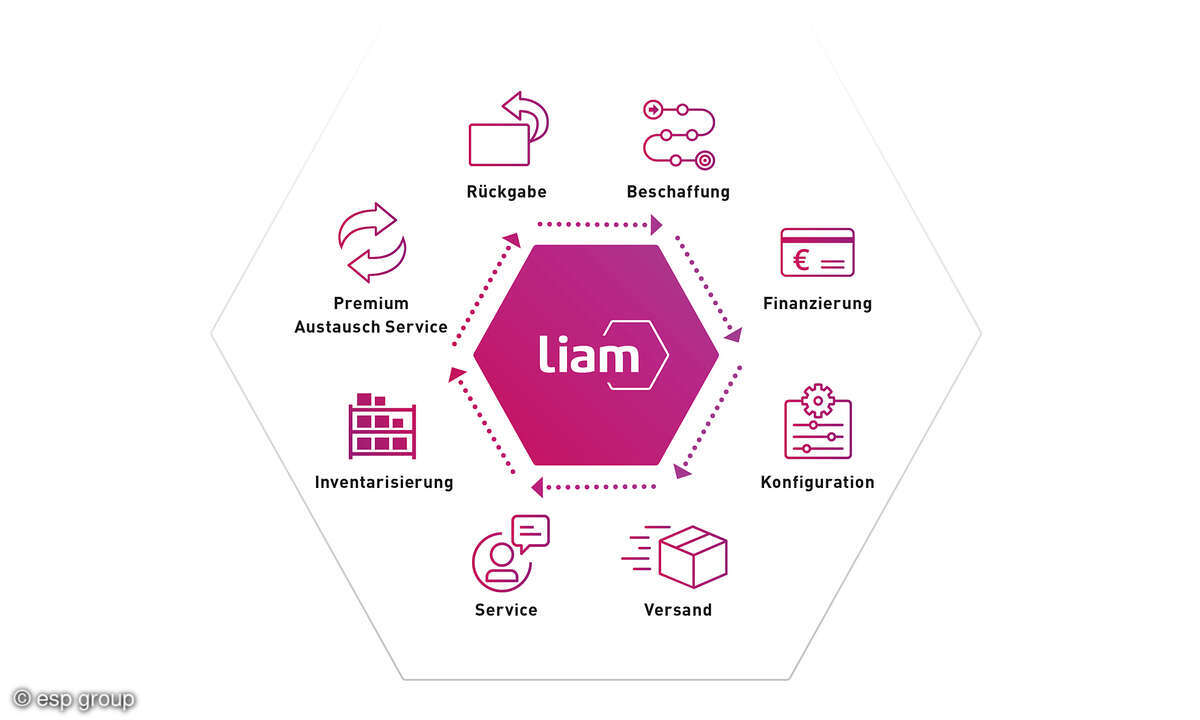Made in Germany – Zukunfts- oder Auslaufmodell?
Made in Germany – ein Qualitätssiegel mit Zukunftspotenzial oder längst überholtes Label? Rainer Koppitz, CEO der Katek SE Group, liefert sechs Thesen zum Thema, die zum Denken anregen.

- Made in Germany – Zukunfts- oder Auslaufmodell?
- Thesen 3 bis 6
Das deutsche produzierende Gewerbe ist schon häufig beerdigt worden. In meiner Jugend in den 80er-Jahren erschien tonnenweise Literatur, die hieb- und stichfest belegen konnte, dass die deutsche produzierende Industrie, allen voran die Automobilindustrie, gerade von den Japanern final überrollt würde. Kam das so? Nein.
Damit sind wir bei meiner ersten These: Nur wer paranoid ist, überlebt! Der permanente Alarmismus in Deutschland hat seine gute Seiten, denn die hellwache deutsche Industrie hat stets schnell gelernt – von den Japaner seinerzeit Themen wie Kanban. Dies und vieles mehr wurde analysiert, verstanden, adaptiert und mit den deutschen Stärken kombiniert. Angst hält fit, solange sie nicht paralysiert. Wenn die deutsche Industrie nicht träge, selbstzufrieden und überheblich wird und, unterstützt von der deutschen Politik und Gesellschaft, sich kontinuierlich mit anderen misst und an den anderen wächst, könnte die Erfolgsstory weitergehen.
Zweite These: Die Zahlen sagen, Made in Germany funktioniert weiter! Made in Germany ist ja nicht zu messen an den Produkten, auf die ein Label geklebt wird (häufig mit minimaler Wertschöpfung in Deutschland), sondern „made“ kommt von „machen“, also Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Nach jahrzehntelangen Unkenrufen müssten alle möglichen Trends von IT, Automatisierung, dem Aufstieg Chinas, dem Arbeitskräftemangel, den hohen Energiekosten, dem Mindestlohn und vieles mehr massiv Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe gekostet haben. Kann ja alles sein – aber der Blick in die Zahlen verrät uns, dass in den letzten fünfzehn Jahren (also 2003 bis 2018) netto sogar weitere Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen worden sind, nämlich über 3% auf jetzt rund 8,3 Millionen insgesamt. Nicht so schlecht.
Die Katek SE Gruppe hat in großem Stil in deutsche Elektronikdienstleister (EMS/ODM) investiert und verfolgt weitere Expansionspläne. Die mir am häufigsten gestellte Frage ist naturgemäß, warum wir dies tun, während doch ganz klar sei, dass man gegen chinesische Firmen und andere Asiaten antrete und diese Schlacht, speziell in der Produktion, nicht gewinnen könne. Unsere Sicht jedoch ist: The best is yet to come! (sang auch Frank Sinatra):
Die deutsche Elektronik-Branche wird eine Renaissance erleben (dritte These). Der vielbeschworene Markt für IoT wird sich binnen zehn Jahren, also zwischen 2015 und 2025 in Bezug auf die Anzahl der aktiven IoT Devices, verfünffacht haben. Diese Devices sind mitnichten nur Gadgets und Consumer Devices, die möglichst billig mit langen Vorlaufzeiten und in Millionenstückzahlen in Asien produziert werden. Wir reden über vernetzte Maschinen, Roboter, landwirtschaftliche Geräte, Drohnen, Stromzähler und Autos gleichermaßen wie auch von unendlich vielen Gerätekategorien, die früher rein mechanisch waren und heute mit intelligenter und vernetzter Elektronik zu IoT Devices geworden sind. Egal ob es Küchenherde oder E-Bikes sind. Alle diese Geräte zeichnet aus, dass sie ohne Elektronik nur leblose, tote Dinge wären, dass sie häufig von deutschen oder europäischen Firmen – oft Mittelständlern – hergestellt werden und dass die wichtigen Elektronikbaugruppen hochkomplex sind in Entwicklung und Herstellung, eine hohe Variantenvielfalt und in der Mehrzahl kleine Stückzahlen aufweisen. Und damit prädestiniert sind für die deutsche Elektronikindustrie, die nah beim Kunden sitzt, bereits bei der Entwicklung helfen kann, geringe Logistikkosten und höchste Flexibilität sowie Qualität aufweist, Ingenieurskunst mitbringt – und Vertrauen in die Waagschale werfen kann.