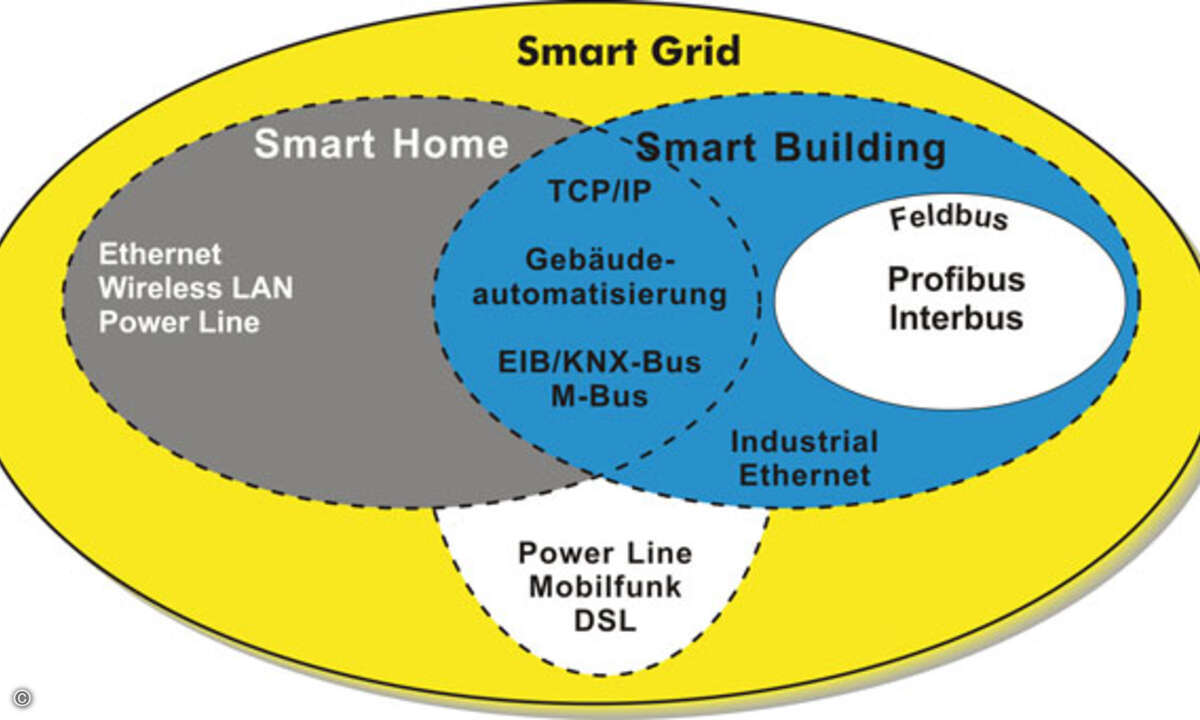Das grosse Grid (Fortsetzung)
- Das grosse Grid
- Das grosse Grid (Fortsetzung)
- Das grosse Grid (Fortsetzung)
- Das grosse Grid (Fortsetzung)
- Das grosse Grid (Fortsetzung)
Bessere Auslastung des Inventars
Statt von Ressourcen-Verbünden spricht man in Anlehnung an Versorgungsbetriebe der Energiewirtschaft, die Leistungen zentral bereitstellen und in der Fläche an die Verbraucher verteilen, oft von Grids. Der Ursprung des Grid Computing liegt in der technisch-wissenschaftlichen Welt. Dort geht es darum, Computer verschiedener Standorte und Einrichtungen zusammenzufassen, um aufwändige Berechnungen und Simulationen durchführen zu können. Dabei kann es sich um Klimamodelle handeln, um Strömungsverläufe bei Automobilen oder um Fragestellungen der Genetik.
Bei der Übertragung von Grid-Konzepten auf den kommerziellen Bereich gibt es vergleichbare Berechnungsszenarien, etwa bei Banken, die ihre Risiken abschätzen wollen. Im Allgemeinen sind betriebswirtschaftliche Anwendungen allerdings nicht rechenintensiv, vielmehr sind sie durch extensive Ein- und Ausgaben gekennzeichnet. Statt der Compute Grids gibt es denn auch Data Grids, die primär für eine breite Verteilung und Verfügbarkeit von Daten sorgen.
Die Hauptstoßrichtung bei den Unternehmen ist, die vorhandenen Ressourcen besser auszulasten, um so Neuanschaffungen vermeiden und Kosten sparen zu können. Denn dimensioniert werden Rechenzentren nach den anwendungsspezifischen Spitzenbelastungen, doch in typischen, durchschnittlichen Situationen wird wesentlich weniger benötigt. Wirtschaftlich ist das nicht. Warum also nicht die Ressourcen nach Bedarf unterschiedlichen Anwendungen zuweisen? Die Belastungsspitzen treten ja nicht bei allen Applikationen gleichzeitig auf.