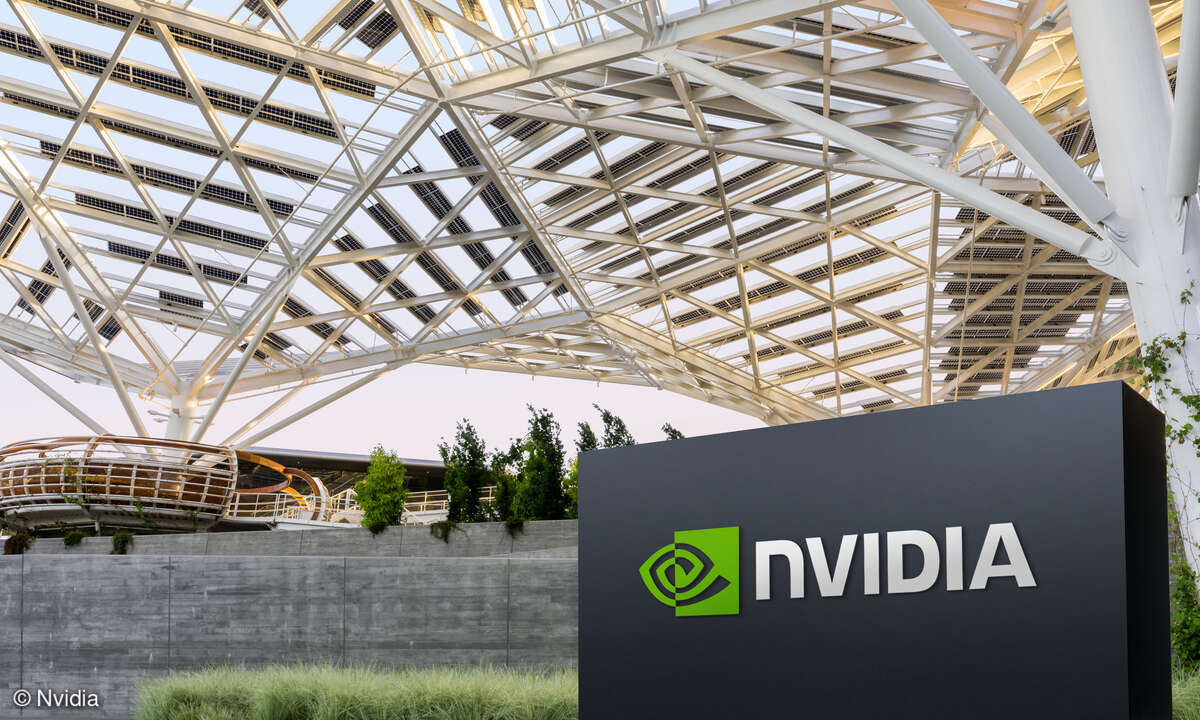Wie ist die gegenwärtige Rechtslage?
- Gebrauchtsoftware: Die Verunsicherung wächst
- Wie ist die gegenwärtige Rechtslage?
- Der Handel mit Second-Hand-Lizenzen bleibt gefährlich
Doch welche der beiden Parteien hat nun Recht? Software ist in der Regel urheberrechtlich geschützt. Eine Antwort auf die Frage, ob ein Softwarenutzer berechtigt ist, eine gebrauchte Software gegen den Willen des Rechteinhabers weiter zu vertreiben, findet sich daher im Urhebergesetz (UrhG).
Alles dreht sich hier um den so genannten »Erschöpfungsgrundsatz gem. § 69 C Nr. 3 Satz 2 Urhebergesetz«. Der Erschöpfungsgrundsatz sagt sinngemäß aus, dass das grundsätzliche Recht des Rechtsinhabers, die Verbreitung seines Werkes vorzunehmen, dann erschöpft ist, wenn ein Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Union im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht wird..
Zweck des Verbreitungsrechts ist es, dem Urheber die alleinige Möglichkeit einzuräumen, durch die erstmalige Veräußerung eine angemessene Gegenleistung für seine Schöpfung zu erhalten. Hat der Rechteinhaber aber mit dem Erstverkauf dann erst einmal sein (Erst-)Verwertungsrecht ausgeübt, hat er es damit verbraucht. Es hat sich in diesem Sinne »erschöpft«.
Ab diesem Zeitpunkt steht das Interesse des Urhebers hinter dem allgemeinen Interesse zurück, dass das bestreffende Werkexemplar im Geschäftsverkehr ungehindert zirkulieren kann. So bewirkt die Erschöpfung, dass ein einmal mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Veräußerung in Handel gebrachtes Original oder Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms auch ohne Einwilligung des Urhebers an Dritte weiterverkauft werden darf. In Bezug auf diese eine bestimmte Werkkopie kann der Urheber eine Weiterverbreitung - sei es durch Verkauf, Tausch oder Schenkung - insoweit nicht mehr verhindern. Wird das Verbreitungsrecht des Lizenznehmers in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen, ist eine solche Klausel gemäß § 307 II, Nr. 1 unwirksam, da sie von wesentlichen gesetzlichen Grundgedanken, nämlich dem Erschöpfungsgrundsatz abweicht.
Hier liegt eine bahnbrechende Entscheidung des BGH vor, die so genannte OEM-Entscheidung aus dem Jahr 2000, Az.: I ZR 244/97. Der BGH hatte den Weiterverkauf von »entbundelter« Software an Endverbraucher für zulässig erklärt. Ist die Software im Original oder als Vervielfältigungsstück erst einmal mit Zustimmung des Urhebers durch Veräußerung in den Verkehr gelangt, so ist sein Verbreitungsrecht in Bezug auf dieses Werkstück gem. §§ 69 C Nr. 3, 17 Abs.2 UrhG erschöpft, so die BGH-Richter. Folglich war es Microsoft seinerseits verwehrt, die nach dem Erstverkauf stattfindende Weiterverkäufe seiner Software zu verbieten, selbst wenn diese ohne die dazugehörige Hardware vertrieben wurde.