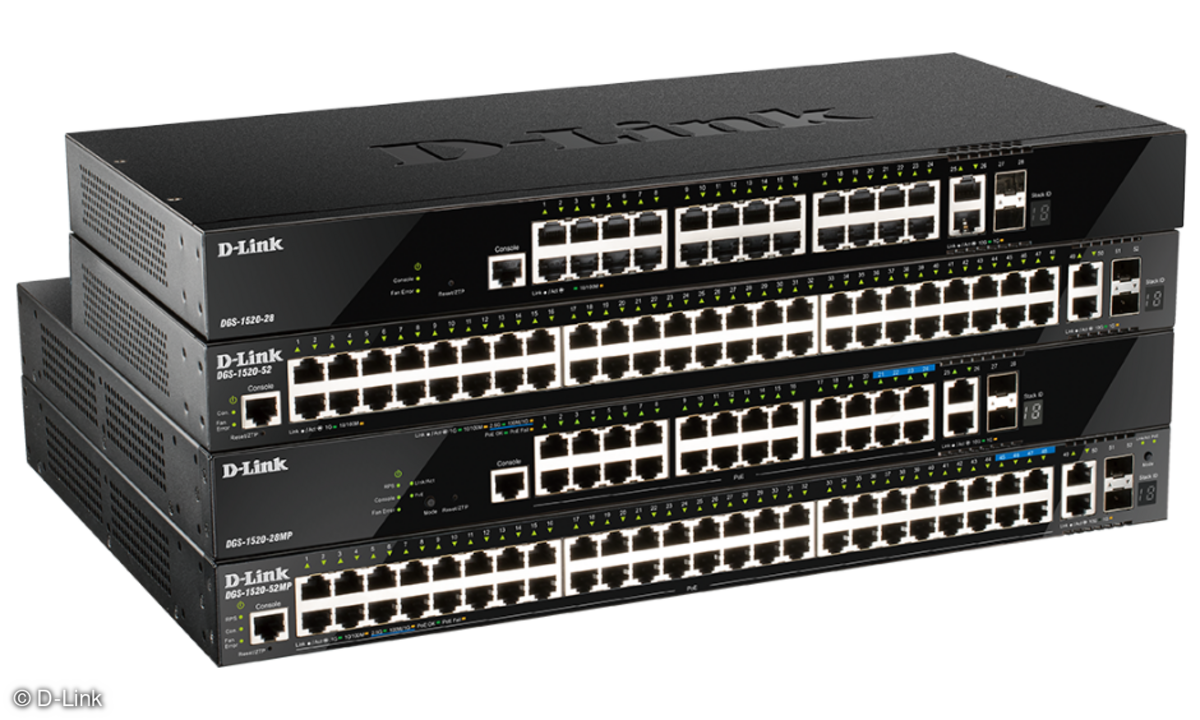Hindernisse auf dem Weg zur Datenautobahn (Fortsetzung)
- Hindernisse auf dem Weg zur Datenautobahn
- Hindernisse auf dem Weg zur Datenautobahn (Fortsetzung)
- Außerirdische unterwegs
- Es darf nichts kosten
- Gütesiegel als Kundenschutz
- Hindernisse auf dem Weg zur Datenautobahn (Fortsetzung)
- Keine 10-Gigabit-Apps
- Hindernisse auf dem Weg zur Datenautobahn (Fortsetzung)
- Marktautomatismus
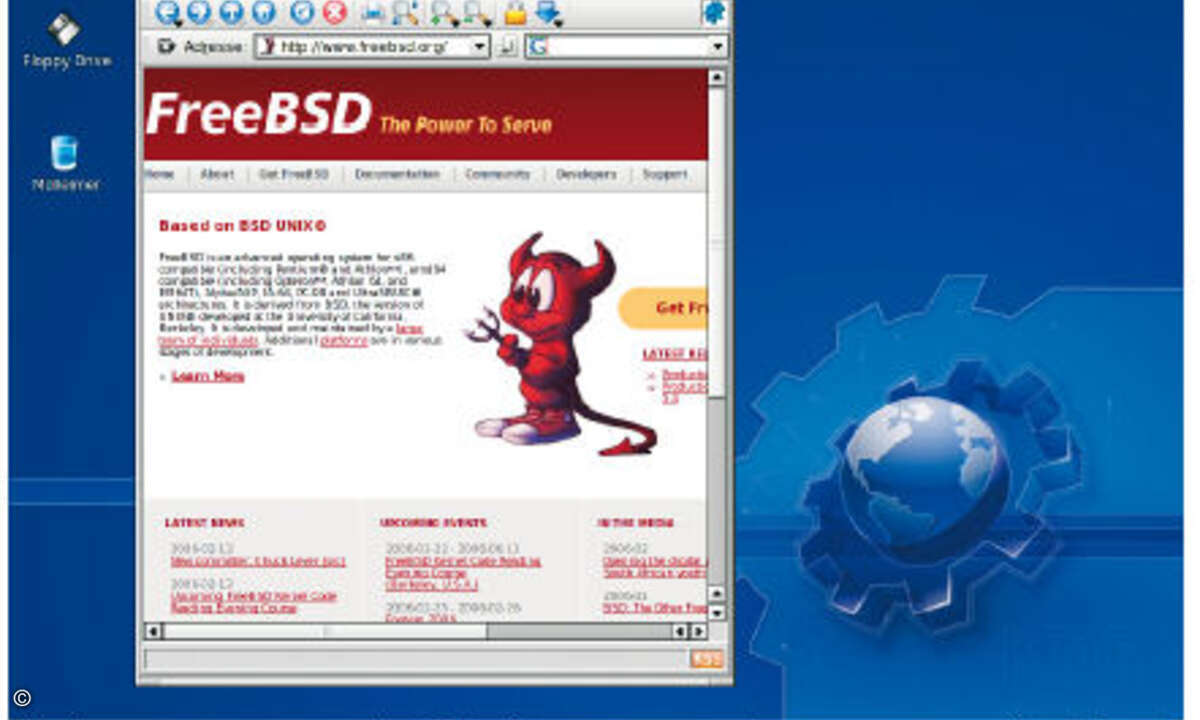
Neues auf LWL-Seite
Klotzbücher weist darauf hin, dass OTDR-Messungen (Optical-Time-Domain-Reflectometry) gemäß dem Standard 14763-3 durchführbar seien, jedoch nur als Erweiterung zu einer Dämpfungsmessung. Dieser Standard mit einer klar definierten Messvorschrift für den Glasfaser-Bereich inklusive der Messmittel sei ein Schritt nach vorn. Damit sei ein zweistufiger Test festgelegt: erstens als Pflichtprogramm zur Dämpfungsmessung, zweitens für die Qualitätssicherung einer OTDR-Messung. Allerdings, so Klotzbücher, sei das Referenzmodell für die Stufe 1 noch umstritten, weil zwei Vorschlagsmodelle konkurrierten. »Klassische OTDR-Messungen sind ohne Dämpfungsmessung aber keine standardkonformen Abnahmemessungen«, schränkt er ein. »Sie sind lediglich dafür geeignet, Ereignisse zu beurteilen und Fehler zu suchen.« Beispiele dafür seien die Beurteilung von Spleißen und Steckverbindungen sowie der Faserdämpfung.
Hüsch bezweifelt, dass die Qualität von Glasfasern in Bezug auf die Bandbreite im Feld geprüft werden könne. Klotzbücher räumt ein: »Bisher sind solche Bandbreitemessungen nur im Labor möglich.« Nach Schleider ist der Faserkauf beim Hersteller ohnehin Vertrauenssache. Und die Hersteller könnten viel versprechen, wenn die Leistungswerte im Feld letztlich nicht nachweisbar seien. Hüsch bezeichnet gegenüber der Vergangenheit das Risiko, schlechte Glasfaser einzukaufen, aber als niedrig. »Mittlerweile steht weltweit gerade mal eine handvoll Hersteller in harter Konkurrenz.« Eine schlechte Verarbeitung der Glasfasern zum Kabel oder eine mangelhafte Installation könne viel eher zu Qualitätsverlusten führen. »Außerdem ist die Messtechnik für LWL verhältnismäßig teuer.« Zudem erfordere das Prüfen der Anschlüsse viel Know-how.
Nach seiner Einschätzung reicht die Dämpfungsmessung als Abnahmetest aus. »Aktive Komponenten haben bestimmte Sendepegel. Empfänger müssen bestimmte Empfangspegel auflösen. That´s it.« Deshalb sei die LWL- im Vergleich zur Kupferkabel-Messtechnik ein wenig trivialer. Das will Klotzbücher so nicht stehen lassen. »Auf den Strecken, wo OTDR für eine hohe Qualität der verlegten Komponenten ran muss oder eine Fehlersuche erforderlich wird, ist die LWL-Messtechnik aufwändiger.« Bei den Strecken, auf denen die Dämpfungsmessung ausreiche, falle hingegen der Messaufwand im Vergleich zur Kupferverkabelung geringer aus. Auch diese Unterscheidung mache das LWL-Kabel zu einer Herausforderung für die Planer.
»Die Extreme im Glasfaserbereich können groß ausfallen«, bestätigt Schleider. Er warnt deshalb die Planer und Installateure davor, ohne notwendiges Know-how die Glasfaser-Verkabelung neben der Kupferverkabelung einfach mitzubearbeiten.
Stiel rät den Teilnehmern, beide Medien, Kupferkabel und Glasfaser, nicht in Gegenpositionen zu bringen. Denn schließlich kämen in den meisten Gewerken beide Medien parallel zum Einsatz.
Schleider: »Deshalb müssen die Planer und Installateure in der Regel beide Verkabelungssysteme aus dem effeff beherrschen. Oder die Aufträge müssen separat an für das jeweilige Verkabelungssystem zuständige Planer und Installateure vergeben werden.« Weil das in der Praxis die Ausgangslage für die Unternehmen unnötig verkompliziere, fordert Klotzbücher die Planer und Installateure auf, sich in beiden Systemen ausbilden zu lassen. Niethammer fragt sich, wer die Norm für LWL im Markt verbreiten soll. Ohne die notwendige Bereitschaft bei den Unternehmen, Planern und Installateuren sieht er auch für LWL ein Informationsproblem.
»Wieso kriegt ein Verlag die Rechte für den Vertrieb sämtlicher Norm-Dokumente, und das für beide Verkabelungssysteme?«, fragt Hüsch. Das mache die Informationsgabe viel zu teuer. Eine Norm koste durchschnittlich 500 Euro. Bei 70, 80 oder 90 Normen komme so ein stattlicher Betrag zusammen. »Das muss die Bereitschaft der Kunden und Planer, normkonform zu handeln, einfach lähmen«, bemerkt er. Gerlach pflichtet bei: »Die Normen müssen als Checkliste via Internet über mehrere Ansprechpartner verfügbar sein. In gleicher Weise müssen die dazugehörigen Referenzen abrufbar sein.« Solange nur ein Verlag das Sagen habe, brauche sich keiner zu wundern, wenn die Botschaften bei den Planern und Unternehmen nicht ankämen. Die BdNI werde alles daran setzen, diesen unhaltbaren Zustand über ihre Technik-Kolloquien für Planer und Unternehmen publik zu machen.
Gerlach schwenkt über zu den aktiven Komponenten. »Wie ist auf dieser Seite der Stand der Normierung und Entwicklung?«