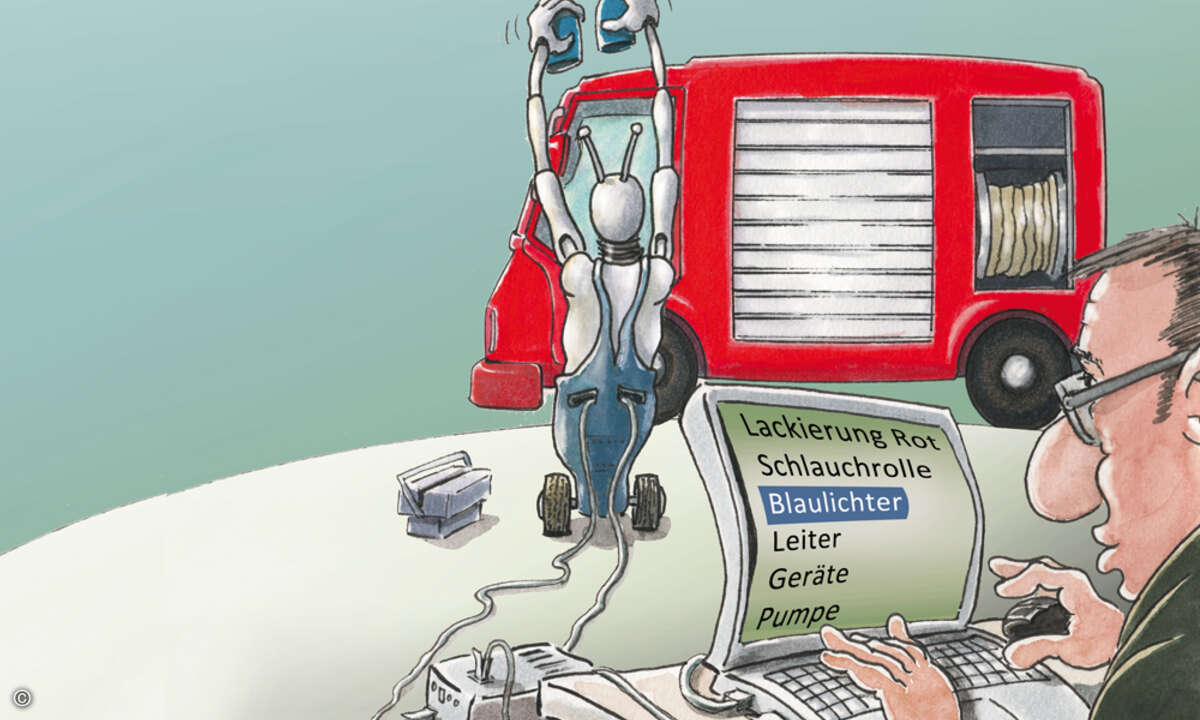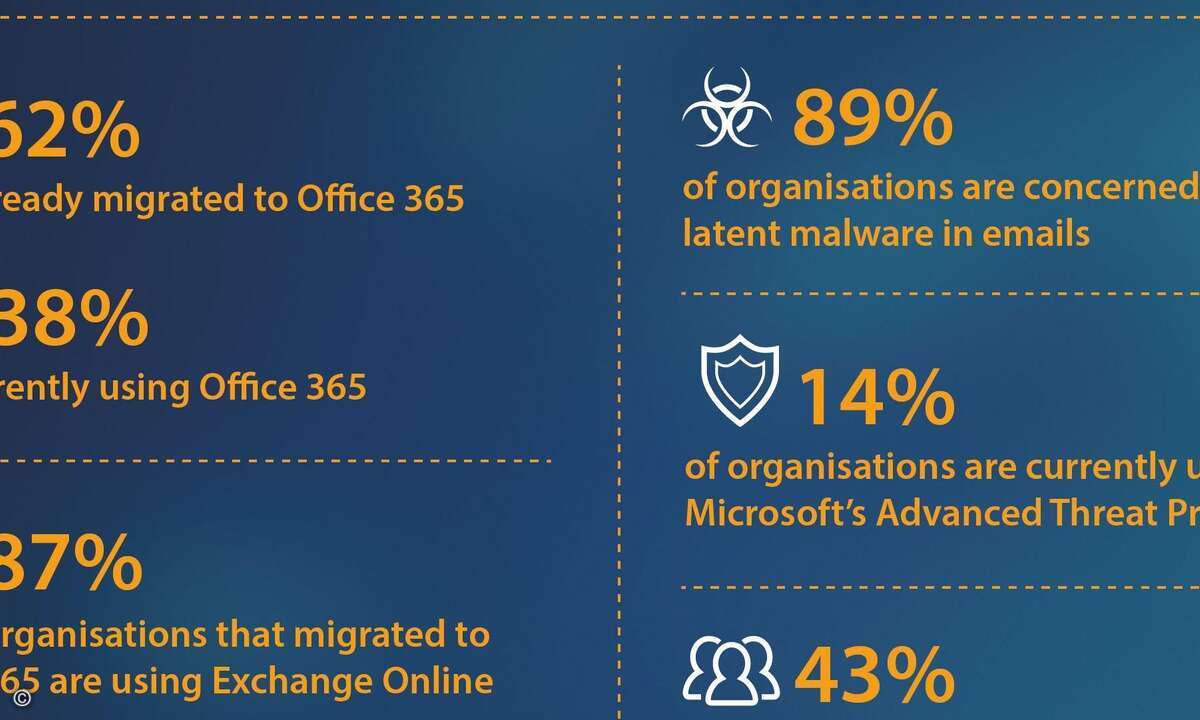Der Konflikt mit EG-Recht
In beiden Fällen standen/stehen nun der eindeutigen Lösungen des deutschen Rechts EG-Richtlinien entgegen. Im Quelle-AG-Fall die Verbraucherschutzrichtlinie 1999/44/EG, im Notebook-Fall die Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG.
Der Quelle-AG-Fall
Der bereits entschiedene Quelle-AG-Fall soll hier nur kurz angesprochen werden. Hier stand der deutschen Regelung Art. 3 der Verbraucherschutzrichtlinie entgegen, welcher besagt, dass eine Nachlieferung vom Verkäufer an den Verbraucher »unentgeltlich« erfolgen müsse.
Der EuGH hatte auf Vorlage des BGH entschieden, Art. 3 der Verbraucherschutzrichtlinie, insbesondere die Formulierung »unentgeltlich« sei dahingehend auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die dem Verkäufer, wenn er ein vertragswidriges (mangelhaftes) Verbrauchsgut geliefert hat, gestattet, vom Verbraucher Wertersatz für die Nutzung des vertragswidrigen Verbrauchsguts bis zu dessen Austausch durch ein neues Verbrauchsgut zu verlangen.
Der BGH hatte daraufhin die Wertersatzpflicht der Käuferin hinsichtlich der Nutzung des Backofens verneint (Urteil vom 26.11.2008, Az.: VIII ZR 200/05). Auch der Gesetzgeber reagierte kurze Zeit später und änderte § 474 Abs. 2 BGB dergestalt, dass beim Verbrauchsgüterkauf § 439 Abs. 4 BGB dahingehend anzuwenden ist, dass Nutzungen nicht herauszugeben sind oder ihr Wert zu ersetzen ist.
Für den Fall der Rückgabe einer mangelhaften Sache ist das Problem des Nutzungsersatzes daher nunmehr vollständig geklärt.
Der Notebook-Fall
Im Notebook-Fall steht der deutschen Regelung Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 der Fernabsatzrichtlinie entgegen. In Art. 6 Abs. 2 heißt es:
»Der Verbraucher kann jeden Vertragsabschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist von mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung widerrufen. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.«
Wie im Quelle-AG-Fall ist hier nun fraglich, ob diese Bestimmungen so ausgelegt werden müssen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die den Käufer im Falle des fristgerechten Widerrufs zum Nutzungsersatz bzw. zum Ersatz des Wertes der Nutzungen verpflichtet. Ist dies der Fall, so muss § 357 BGB, der die Rechtsfolgen des Widerrufs regelt (s.o.), richtlinienkonform ausgelegt und auf kurz oder lang geändert werden.
Diese Frage wurde vom den Fall verhandelnden AG Lahr dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt (Vorlagebeschluss Az.: 5 C 138/07; EuGH Az.: C-489/07).