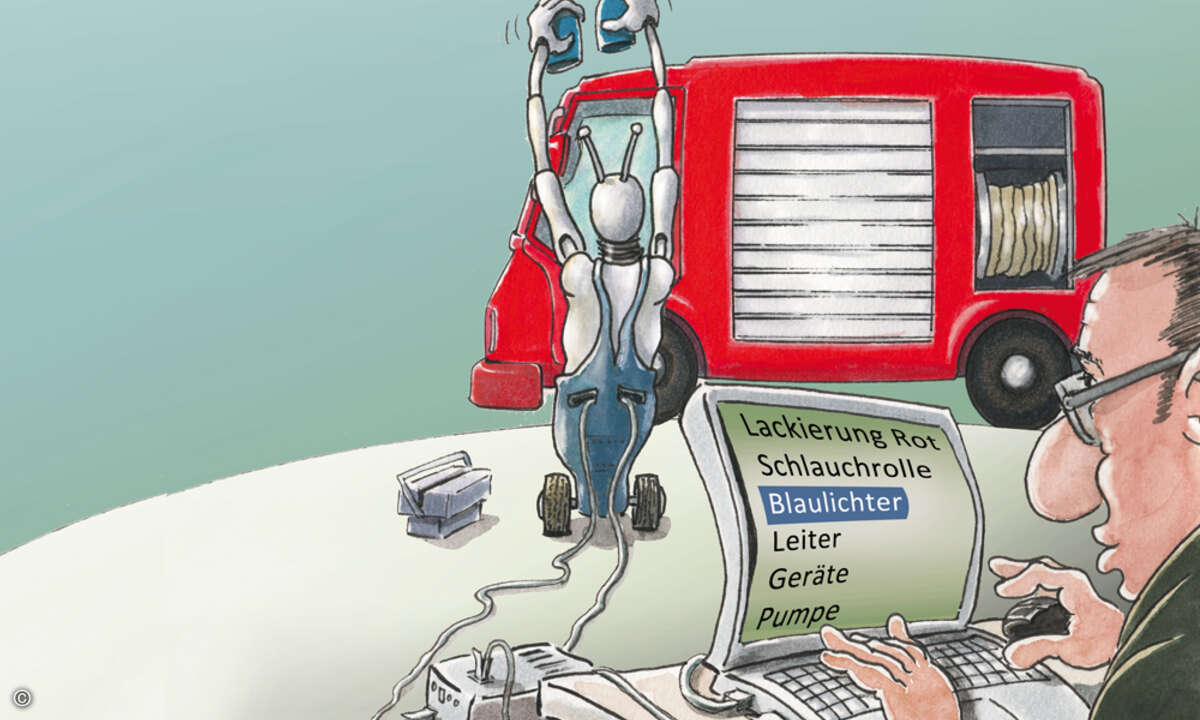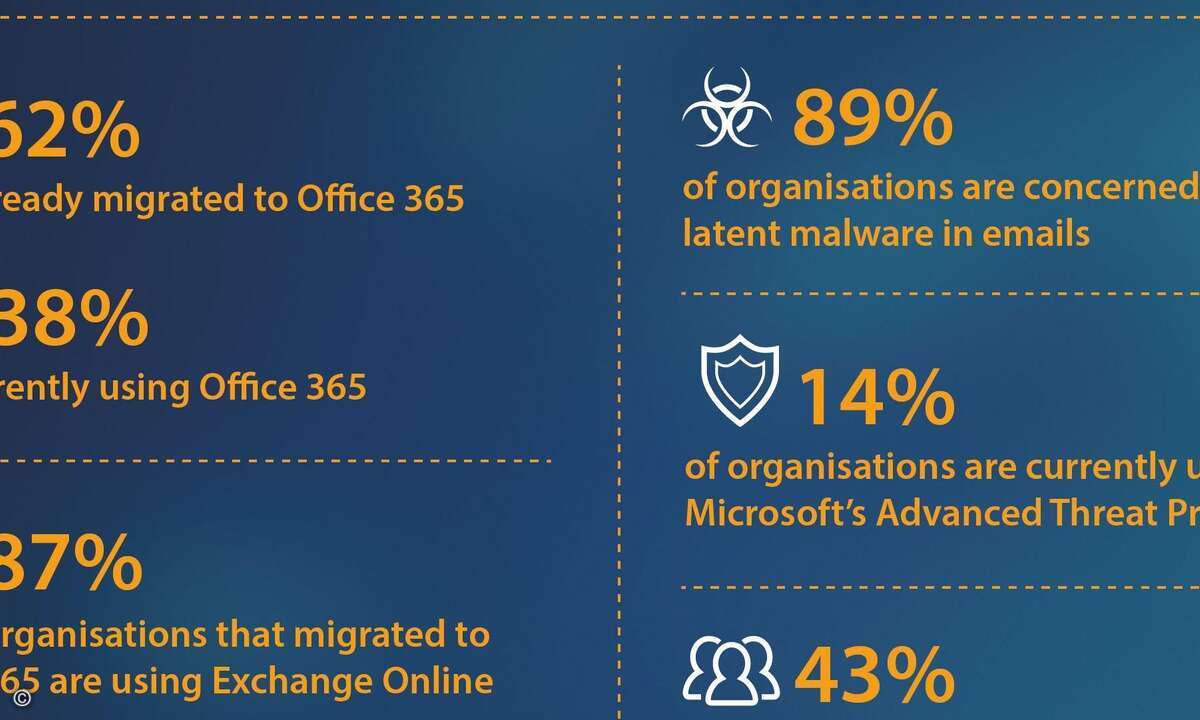Schlussantrag der Generalanwältin
Die Generalanwältin Verica Trstenjak stellt in ihrem Schlussantrag zunächst den Unterschied zwischen Nutzungswertersatz und Abnutzungswertersatz dar, bevor sie auf die Frage der Richtlinienkonformität eingeht. Ersterer stellt den Ersatz von Nutzungen in Form einer Art Leihgebühr dar. Letzterer hingegen meint den Ersatz von Verschlechterungen, die sich auf Grund des Gebrauchs an der Sache ergeben haben. Im Notebook-Fall geht es nur um den Nutzungswertersatz.
Ein solcher Nutzungswertersatz stellt nach Ansicht der Generalanwältin keine Strafzahlung im Sinne des Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie dar. Jedoch müsse der Begriff der Kosten in Art. 6 Abs. 2 weit verstanden werden, sodass ein Nutzungswertersatz darunter falle. Ein Wertersatz für Nutzungen wie der nach deutschem Recht stelle eine finanzielle Belastung dar, welche die Funktionsfähigkeit und Effektivität des Rechts auf Widerruf beeinträchtigen kann, sodass das Widerrufsrecht zu einem rein formalen Recht verkomme.
Daher sei die deutsche Regelung nicht mit der Richtlinie vereinbar.
Das finanzielle Risiko, dass dem Verkäufer entsteht, wenn er keinen Nutzungsersatz verlangen kann, sei aufgrund der in der Regel kurzen Widerrufsfristen von sieben oder vierzehn Tagen gering. Eine etwaige Verlängerung der Widerrufsfrist, die einen Nutzungswertersatz notwendig erscheinen lässt, sei regelmäßig auf ein Fehlverhalten des Verkäufers - Nichterfüllung der Informationspflichten - zurückzuführen und rechtfertige daher keine Schlechterstellung des Verbrauchers. Außerdem könne der Verkäufer das Risiko durch Einkalkulierung eines prozentualen Rücklaufs in seine Preise, sprich durch Umlegen der Kosten auf den Warenpreis und damit auf alle Käufer, kompensieren.
Schließlich weist die Generalanwältin noch darauf hin, dass die Möglichkeit eines Missbrauchs dieser Regelung durch Einzelne (etwa durch Bestellen von Waren, nur um diese innerhalb des Widerrufszeitraums zu benützen und dann rechtzeitig zurückzusenden) nicht zu Lasten aller Verbraucher gehen dürfe. Die Missbrauchsgefahr rechtfertige daher die Nutzungswertersatzpflicht nicht.