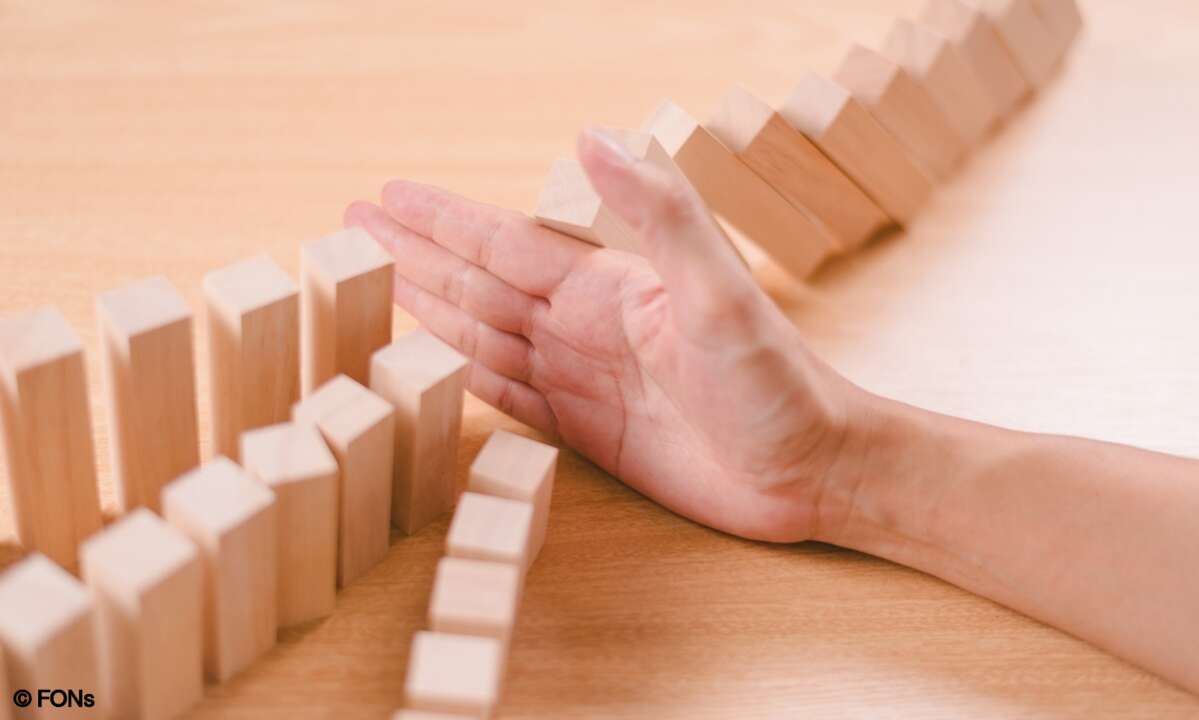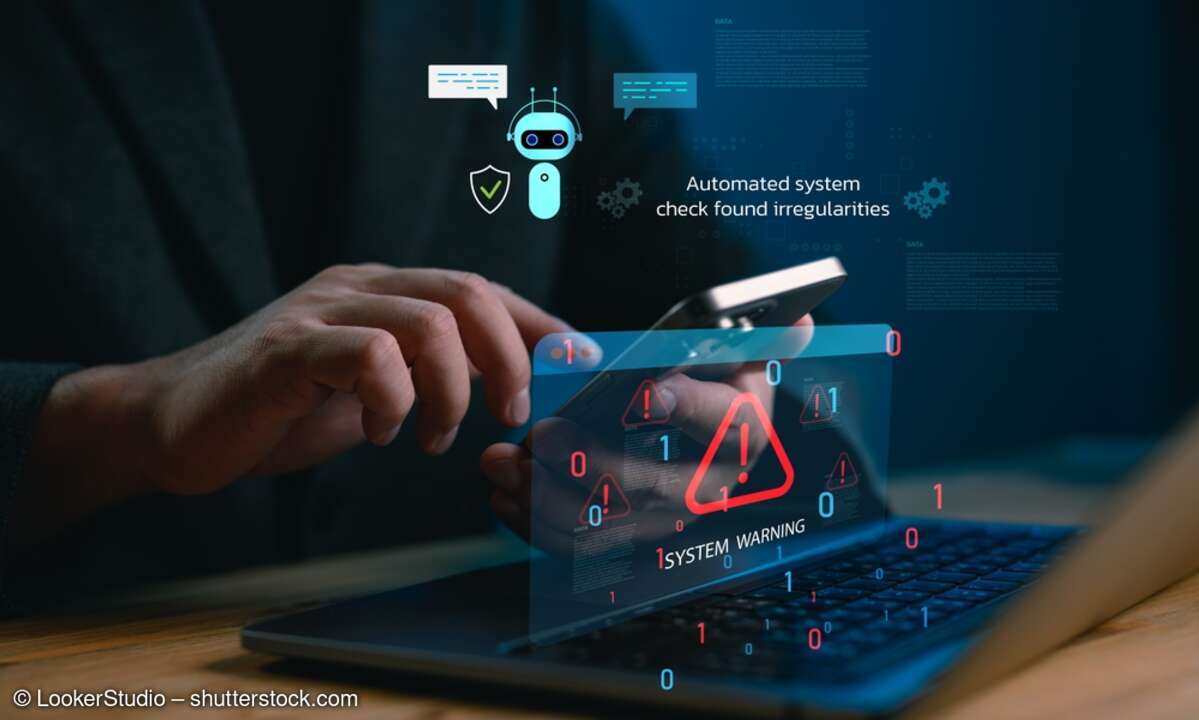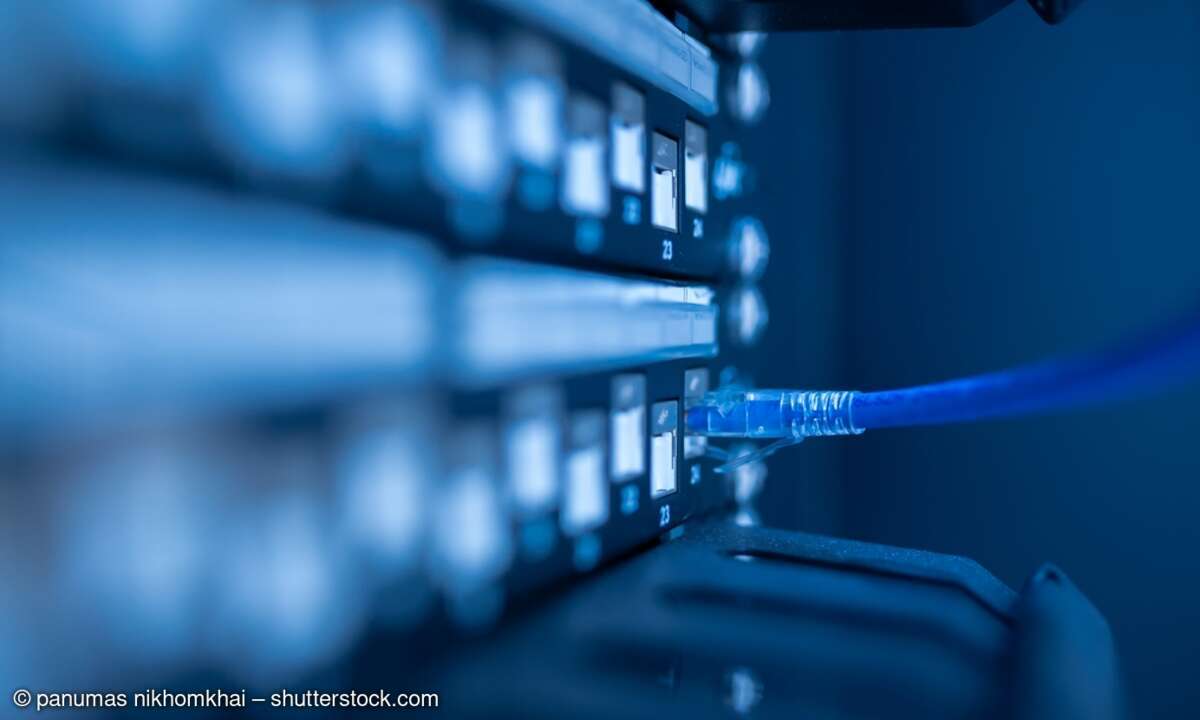Einschränkung des Listenprivilegs
- Opt-out ist demnächst absolut out
- Informationspflicht bei Datenlecks
- Wann tritt Melde- und Informationspflicht ein?
- Mindestinhalte für die Information
- Einschränkung des Listenprivilegs

Die Bundesregierung nimmt die Datenskandale vom Herbst 2008 zum Anlass, die Datennutzung für Werbezwecke erheblich zu reglementieren. Heftigen Widerstand insbesondere aus der Werbewirtschaft haben in diesem Zusammenhang die Pläne zur Einschränkung des Listenprivilegs erregt. Nach geltendem Recht können insbesondere die Namen, Anschriften und das Geburtsjahr von Personen nach einem Gruppenmerkmal listenmäßig zusammengestellt, für Werbezwecke an ein anderes Unternehmen übermittelt und von diesem genutzt werden (sogenanntes Listenprivileg). Nach dem neuen Recht muss sich derjenige, der personenbezogene Daten nach dem 1. Juli 2009 erhebt und für Werbezwecke übermitteln oder nutzen möchte, in den meisten Fällen beim Werbeadressaten zuvor eine qualifizierte Einwilligung holen. Das Listenprivileg wird zulasten des Adresshandels erheblich eingeschränkt. Für personenbezogene Daten, die vor dem 1. Juli 2009 erhoben wurden, soll das alte Listenprivileg bis zum 1. Juli 2012 fortgelten. Diese dreijährige Übergangsfrist würde es den Unternehmen ermöglichen, fehlende qualifizierte Einwilligungen bei den Betroffenen – soweit möglich – nachträglich einzuholen. Das Listenprivileg bleibt nur ganz begrenzt erhalten für die Geschäftswerbung gegenüber freiberuflich und gewerblich Tätigen. Auch soll die Spendenwerbung privilegiert bleiben. Im Übrigen wird es auf die Eigenwerbung gegenüber Bestandskunden beschränkt. Begünstigt sind nur noch Kundendaten, die das werbende Unternehmen selbst erhoben hat; die Werbung gegenüber Neukunden ist nicht mehr erfasst. Für fremde Produkte bleibt ohne qualifizierte Einwilligung nur die Möglichkeit der Beipackwerbung, die der Kommunikation mit dem eigenen Kunden hinzugefügt wird. Wie bisher kann der Kunde der Übermittlung und Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken widersprechen. Neu ist, dass der Kunde bereits beim Vertragsschluss über sein Widerspruchsrecht zu belehren ist. Versendet das Unternehmen nach einem Widerspruch noch Werbung an den Kunden, kann die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld von bis zu 300000 Euro verhängen. Erteilt der Kunde die Einwilligung mündlich, etwa am Telefon, muss das Unternehmen die erteilte Einwilligung anschließend schriftlich bestätigen. Damit soll späterer Streit über den genauen Wortlaut der Einwilligung vermieden werden. Wird die Einwilligung elektronisch erteilt, etwa per E-Mail oder durch Ankreuzen einer Check-Box auf einem Online-Formular, muss der Kunde den Einwilligungstext jederzeit abrufen und widerrufen können. Praktisch wird das darauf hinauslaufen, dass das Unternehmen den Einwilligungstext online abrufbar hält und dort auch die Kontaktdaten für einen Widerruf der Einwilligung angibt. Die Einwilligung muss künftig durch eine aktive Erklärungshandlung des Kunden, etwa ein Ankreuzen erfolgen. Das vom Bundesgerichtshof noch im Sommer 2008 in der Payback-Entscheidung gutgeheißene »Opt-out« ist künftig auch für die Briefwerbung vom Tisch. Unternehmen werden dies bei der Neukonzeption ihrer Formulare zu berücksichtigen haben. Marktbeherrschenden Unternehmen soll es schließlich verboten werden, ihre Leistung an eine qualifizierte Einwilligung für die werbliche Datenverwendung zu koppeln, wie dies bisher nur für Telemediendienste ausdrücklich geregelt war. Damit fällt ein weiterer Unterschied zwischen Online- und Briefwerbung weg.
Dr. Stefan Hanloser ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Howrey LLP in München