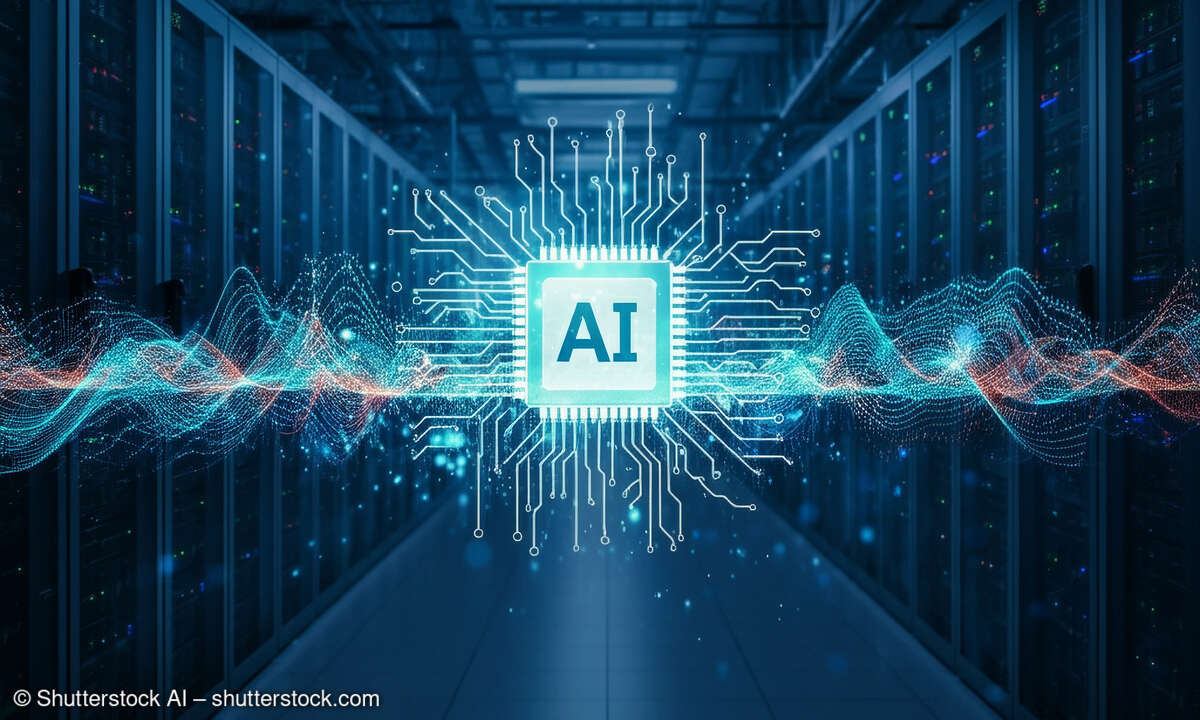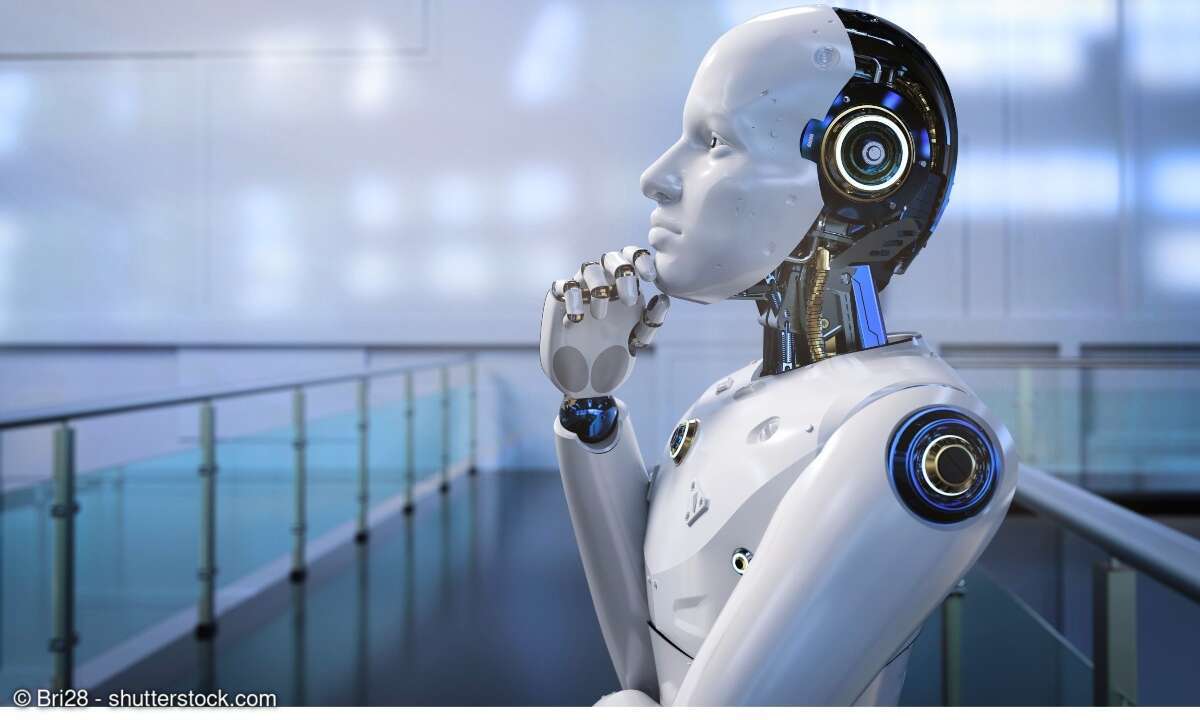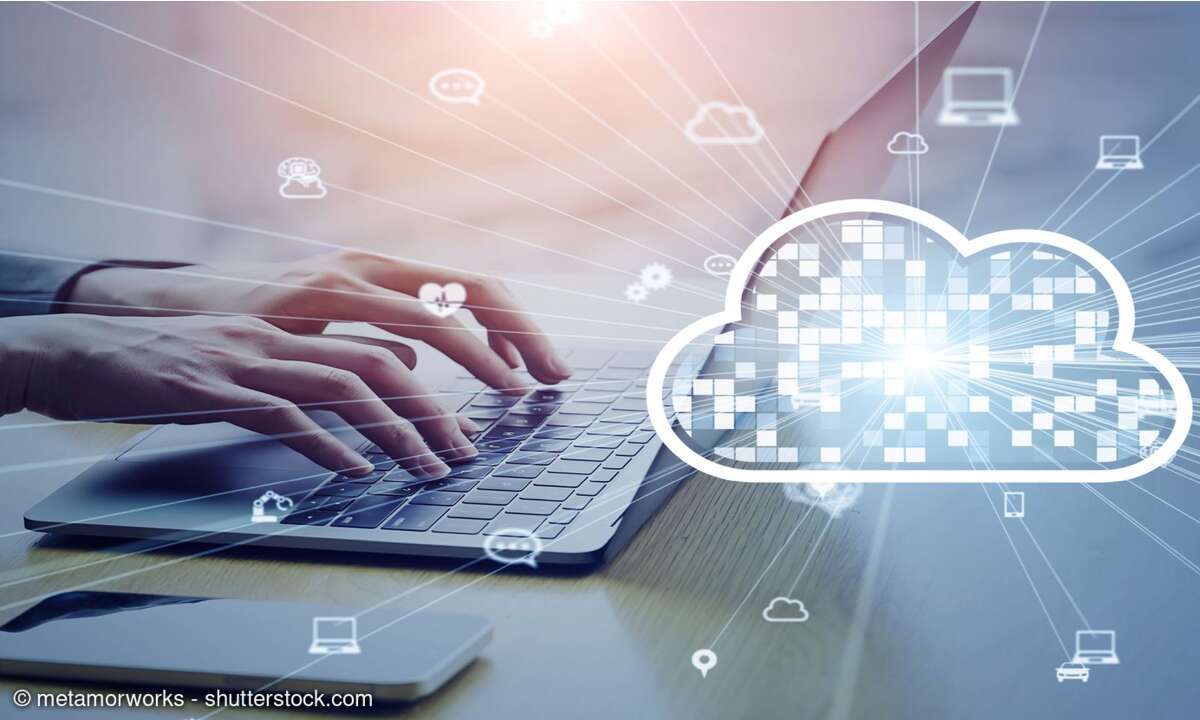Priorisierung im Breitbandausbau zwingend notwendig
- Deutschland in der digitalen Transformation
- In fünf Jahren soll das Internet der Dinge Alltag sein
- Priorisierung im Breitbandausbau zwingend notwendig
- Herausforderung Netzausbau und -verdichtung
- Politik und Wirtschaft stärker vernetzen
Damit Deutschland seine selbst gesteckten Ziele in Bezug auf den Breitbandausbau im Plan-Horizont erreicht, sollte man über die Netzkonvergenz nachdenken – ein Weg, der noch viel zu selten genutzt wird. Richtig angewandt bietet die Kombination verschiedener Netztypen große Chancen, wie zum Beispiel mit dem intelligenten Hybrid-Anschluss, der automatisch vorhandene Bandbreiten aus Festnetz und Mobilfunk bündelt. Geht man jedoch in den Anforderungen zu weit, kann die gemeinsame Nutzung verschiedener Netzarten auch überhöhte Kosten verursachen. Ein Beispiel hierfür ist ein "seamless hand-over" zwischen Festnetz und Mobilfunk. Der Grenznutzen steht hier in keinem Verhältnis zum damit verbundenen technischen Aufwand. Insofern muss der Fokus auf der optimalen Kombination der Infrastrukturen liegen, um unnötige Redundanz zu vermeiden.
Unumgänglich ist auch eine Diskussion zum Thema Bestandschutz. Investoren erwarten regulatorische Stabilität – nach dem Motto: Wer investiert hat, muss die Chance haben, die eingesetzten Mittel innerhalb einer ökonomisch realistischen Zeit zurückzuverdienen. Ein berechtigtes Interesse. Auf der anderen Seite verlangt die Regulierungsbehörde mit Blick auf die Verbraucher, dass Infrastruktur allen zugänglich sein muss. Allerdings haben Netzbetreiber weitere erhebliche Belastungen zu tragen, etwa die Lizenzgebühren für zusätzliche Frequenzen. Bei der jüngs-ten Lizenzversteigerung breitbandiger Mobilfunkfrequenzen (DVB-T2), auch Digitale Dividende 2 genannt, nahm der Staat im Juni 2015 rund 5,1 Milliarden Euro ein – ein Bruchteil der legendären UMTS-Auktion im Jahr 2000 (50,8 Milliarden Euro) und etwas mehr als bei der Auktion der ersten digitalen Dividende vor vier Jahren (4,4 Milliarden Euro). Denn klar ist: Jeder Euro, der für Lizenzen ausgegeben werden muss, geht dem Ausbau verloren. Nicht nur deshalb wird es unausweichlich sein, nach der Versorgung der Ballungszentren den weiteren Breitbandausbau in der Fläche zu priorisieren, denn mit jedem weiteren Ausbauschritt sinkt für privatwirtschaftliche Investoren die Profitabilität. Eine Herausforderung, da die Interessen von Kommunen und Netzbetreibern zwangsläufig nichtimmer deckungsgleich sind.
Der Staat hat das Dilemma erkannt. Deshalb hat er für den weiteren Ausbau noch einmal zusätzlich 3 Milliarden Euro bereitgestellt, weitere 1,3 Milliarden Euro aus der aktuellen Frequenzversteigerung fließen ebenfalls in Förderprogramme rund um den Breitbandausbau. Die erfolgreichen Bieter – 2015 waren das Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland – gehen mit dem Lizenzerwerb die Verpflichtung ein, innerhalb von drei Jahren min-destens 97 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland und 98 Prozent der Haushalte mit Breitbandverbindung und Übertragungsraten von 50 MBit/s zu versorgen.
Bei der Entscheidung, wo vorhandene Mittel am besten eingesetzt werden, sind sowohl politische Aspekte als auch ökonomische Belange zu beachten. Ziel muss es sein, den sowohl technologisch als auch wirtschaftlich besten Kompromiss zu finden,um strukturschwache Regionen zu stärken und den Bandbreitenbedarf von Unter-nehmen mit Blick auf Industrie 4.0 zu bedienen. Dabei sind sowohl redundante Strukturen als auch "weiße Flecken" zu minimieren. Eine komplexe Aufgabe, die im Spannungsfeld privatwirtschaftlicher und öffentlicher Interessen am ehesten aus einer neutralen Perspektive auf die Gesamt-situation zu lösen ist und die langjähriger Branchen-Erfahrung als auch kaufmännischer, konzeptioneller und geoanalytischer Kompetenzen bedarf.
Eine Mittlerrolle, wie sie beispielsweise TÜV Rheinland besetzt. Die Spezialisten begleiten Bundesländer, Landkreise und Kommunen seit Jahren bei der Entwicklung ihrer digitalen Zukunftsstrategie. Im Rahmen einer Netzplanung analysieren Teams die Ist-Situation, prüfen, ob bereits privatwirtschaftliche Initiativen für den Netzausbau in Planung oder Umsetzung sind, ob benachbarte Infrastrukturen genutzt werden können und welche Netzkonzepte in Frage kommen. Auf dieser Basis entsteht eine umfassende Netzplanung, die sowohl die aktuellen Hausanschlüsse und vorhandene Infrastrukturen berücksichtigt als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune sowie die Siedlungs- und Gewerbegebietsplanung der nächsten Jahre.