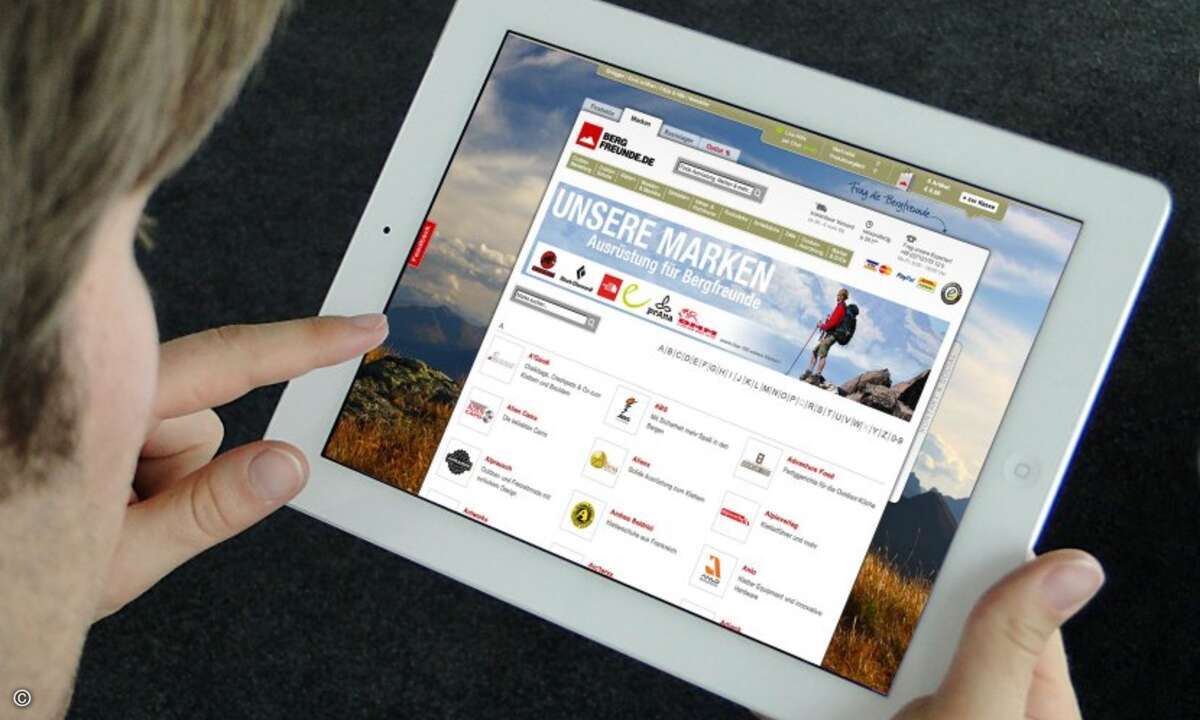Business Intelligence: Wer richtig auswählt, spart Zeit und Geld
Reporting und Analyse gehören zu den klassischen Themen der Business Intelligence. Wegen der dezentralen Verwendung entsprechender Software nutzen die Unternehmen Optimierungspotenziale bei der Anschaffung der Produkte allerdings oft nicht aus.

- Business Intelligence: Wer richtig auswählt, spart Zeit und Geld
- Aufstellung der Kritierien und Durchführung der Analyse
- Zahlreiche funktionale Auswahlkriterien
- Nicht-funktionale Kriterien ebenfalls wichtig
- Szenario aus der Praxis
Anders als bei Prozesssystemen, die ihre Wirtschaftlichkeit durch optimierte Durchlaufzeiten oder Automatisierung nachweisen müssen, erfolgt die Auswahl von Reporting- und Analysesystemen häufig nachrangig, mit geringerer Sorgfalt und durch kurzfristige Entscheidung einzelner. Begründung ist vielfach mangelnde Zeit und ein nicht ausreichend bestimmbarer Business Case. Die Konsequenzen einer weniger gründlichen Softwareauswahl sind nicht selten Unzufriedenheit bei den Anwendern, geringere Akzeptanz der Berichte und des darin steckenden Geschäftswissens, sowie verzögerte Entscheidungsprozesse. Unternehmen entstehen damit kritische Wettbewerbsnachteile.
Durch ein aufmerksames und systematisches Entscheidungsverfahren kombiniert mit einem individuell gewichteten Kriterienkatalog können Unternehmen diesem Risiko vorbeugen und eine Reporting- und Analyselösung nachhaltig auswählen.
Typische Auswahlverfahren orientieren sich an der Methodik der Nutzwertanalyse oder dem analytischen Hierarchieprozess. Sie sollten zumindest diese vier Phasen enthalten:
1. Abstimmen des Verfahrens
2. Aufstellen und Gewichten der Kriterien
3. Analyse der Alternativen gegen diese Kriterien
4. abschließende Auswertung als Entscheidungsgrundlage
Hierbei gilt es, verschiedene Hürden zu nehmen und von Best-Practice-Ansätzen zu profitieren. So sollten die Kriterien möglichst vollständig sein, alle Aspekte berücksichtigen und sich nicht überlappen. KO-Kriterien sollten deutlich gemacht werden und zuerst bewertet werden, um Aufwand zu sparen. Ein Tipp zur Bewertungsskala: eine gerade Anzahl von Noten zwingt auf jeden Fall zu einer Tendenzaussage und verhindert wenig hilfreiche Wohlfühl-Antworten. Testet man vorab die gewichteten Kriterien innerhalb der Matrix durch Minimal- und Maximalwerte, lassen sich zu starke aber auch zu schwache Hebel identifizieren und beheben.