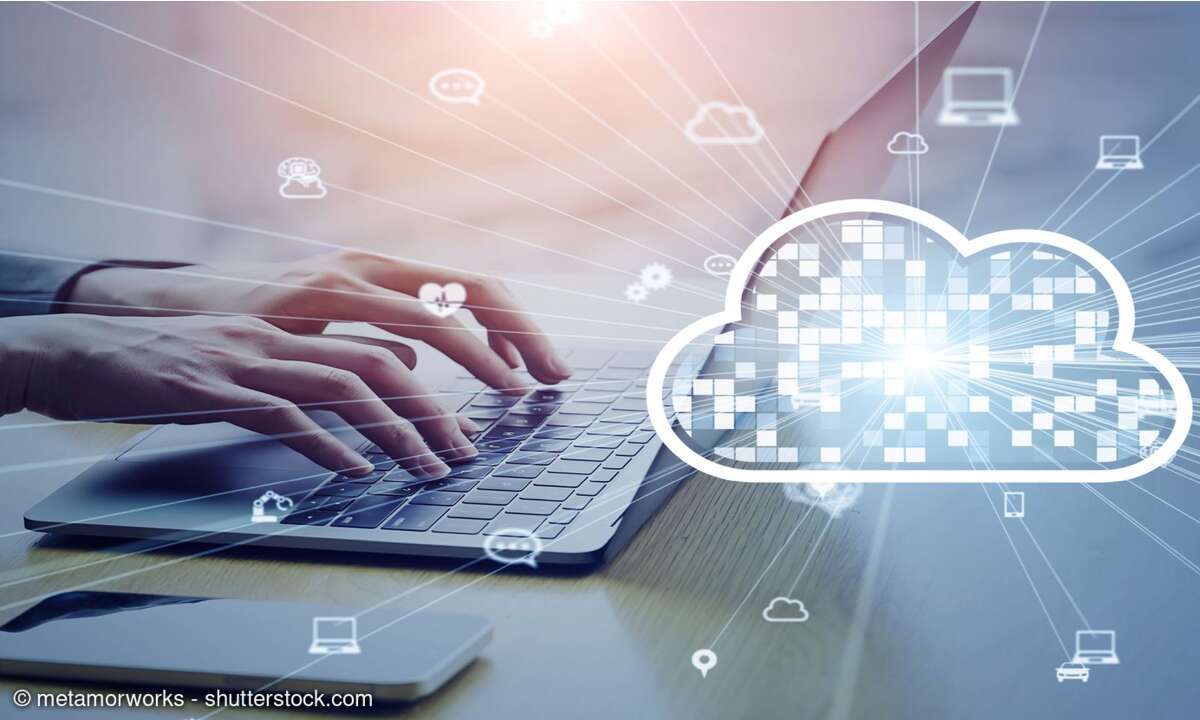Zeit für digitale Denker
Deutschland fehlen die Digitalspezialisten, das hat erst kürzlich die halbjährliche Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) gezeigt. Doch gerade Fachkräfte und Führungspersönlichkeiten werden dringend gebraucht. Was müssen wir als nächstes tun?

- Zeit für digitale Denker
- Neue Geschäftsmodelle gefordert
- Kurz nachgefragt
„Die digitale Revolution ist möglicherweise radikaler und umfassender als alle bisherigen technologischen Erneuerungen. Was passiert in Deutschland? Bei Weitem nicht genug!“ – Ein Auszug aus dem Vorwort der Studie „Digitale Transformation 2018“ von Philipp Depiereux, Gründer und Geschäftsführer bei Etventure, der wie eine Ohrfeige klingt. Deutschland habe die rasante Entwicklung bislang nur staunend begleitet, statt aktiv daran teilzuhaben, heißt es weiter. Vielen Unternehmen falle es nach wie vor schwer, zu verstehen und zu akzeptieren, dass ihr Geschäft, das ihnen jahrzehntelang ein sicheres Einkommen bescherte, von einigen wenigen Tech-Unternehmen oder Start-ups aus Übersee bedroht sein könnte. Bereits zum dritten Mal liefert Etventure gemeinsam mit der GfK eine Bestandsaufnahme der Digitalen Transformation in deutschen Großunternehmen. Fazit: Deutschland wartet ab, wiegt sich in Sicherheit. Das Problem: Nur mal eben das bestehende Geschäft oder die IT zu optimieren, reicht nicht. Geschäftsmodelle kritisch hinterfragen, disruptiv angreifen, nur so könne man Boden gutmachen, meint Depiereux. Die gute Nachricht: Deutschland hat alle Voraussetzungen, um in der digitalen Welt zu bestehen, selbst anzugreifen und mehr als nur Mittelmaß zu sein. Davon ist auch Bitkom-Präsident Achim Berg überzeugt: „Deutschland hat bei vielen Zukunftstechnologien eine hervorragende Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb: 3D-Druck, Blockchain, Internet of Things, Künstliche Intelligenz. Aber andere holen schnell auf. Wenn etwa China KI als Zukunftsthema identifiziert, dann werden dort in kürzester Zeit Milliardensummen bereitgestellt.“ Anders in Deutschland: Dem Bitkom zufolge steckt man hierzulande lediglich 25 Milliarden Euro pro Jahr in die Zukunftsforschung und davon viel zu wenig in Digitales. Dabei müsse jeder zweite Forschungseuro in digitale Schlüsseltechnologien investiert werden, damit die Chancen konsequent genutzt und vorhandene Risiken gemieden werden könnten. „Wenn wir heute die Weichen richtig stellen, wird die Digitalisierung für Deutschland eine Gewinnergeschichte“, erklärt Berg. Doch der Weg dahin ist noch ein weiter. Denn es gibt noch mehr zu tun: die Digitalisierung von Bildung und Verwaltung, die digitale Ertüchtigung der Verkehrs- und Energienetze, der Aufbau von Gigabitnetzen in der Telekommunikation.
Innovation abseits der Technologie oder der Faktor Mensch
„Die größte Herausforderung wird der Fachkräftemangel sein“, erklärt Alexander Nouak, Geschäftsführer des Fraunhofer-Verbunds IUK-Technologie. Die Gründe sind naheliegend: So erfordern neue Technologien wie maschinelles Lernen oder Big Data in erster Linie das nötige Fachpersonal. So müsse in Deutschland noch viel stärker diesbezüglich aus- und weitergebildet werden – und zwar nicht nur in der Informatik, sondern auch in den Anwendungsdisziplinen, also noch interdisziplinärer. Zusätzlich müssten entsprechende Arbeitskräfte global angeworben werden, was, wie Nouak zugeben muss, angesichts des weltweiten Wettbewerbs um Talente eine echte Herausforderung ist.
Während einerseits händeringend Fachkräfte gesucht werden, grassiert an anderen Stellen die nackte Angst, dass viele Arbeitsplätze dem digitalen Fortschritt zum Opfer fallen könnten. Insbesondere die Gewerkschaften seien diejenigen, die regelrecht eine „Digitalisierungsangst“ schürten, meint Peter Stroetmann, Geschäftsführer bei Seamcom: „Die Politik täte gut daran, die in Deutschland immer stärker wachsende Digitalisierung auch an der Basis positiv mitzugestalten. Es gilt zu vermitteln, dass die Digitalisierung auch dazu führen kann, dass es neue Branchen und Dienstleistungen geben wird, die wiederum den Menschen neue Chancen bieten. Statt in Verlusten zu denken, besteht die Herausforderung aller Wirtschafts- und Industriezweige darin, Neues zu schaffen und innovativ und kreativ zu agieren.“ Dass nur gemeinsames Handeln zum Erfolg führen kann, glaubt auch Nouak: „Innovation entsteht nicht allein durch Technologie, sondern auch dadurch, alle Menschen mitzunehmen.“ Als Beispiel führt er das Problem der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an: So habe die Unterversorgung in diesen Gebieten, die den mangelnden finanziellen Anreizen für Anbieter geschuldet ist, zur Folge, dass sich neue Firmen lieber in ohnehin schon infrastrukturstarken Regionen ansiedeln – die Breitbandversorgung wird zum Standortentscheidungskriterium. Und selbst vor der Agrarwirtschaft macht diese Entwicklung nicht halt: Smart Farming macht schließlich ohne eine flächendeckende Breitbandversorgung kaum Sinn. „Die digitale Wende muss für alle da sein und darf auch nicht an Ländergrenzen enden“, mahnt Nouak.