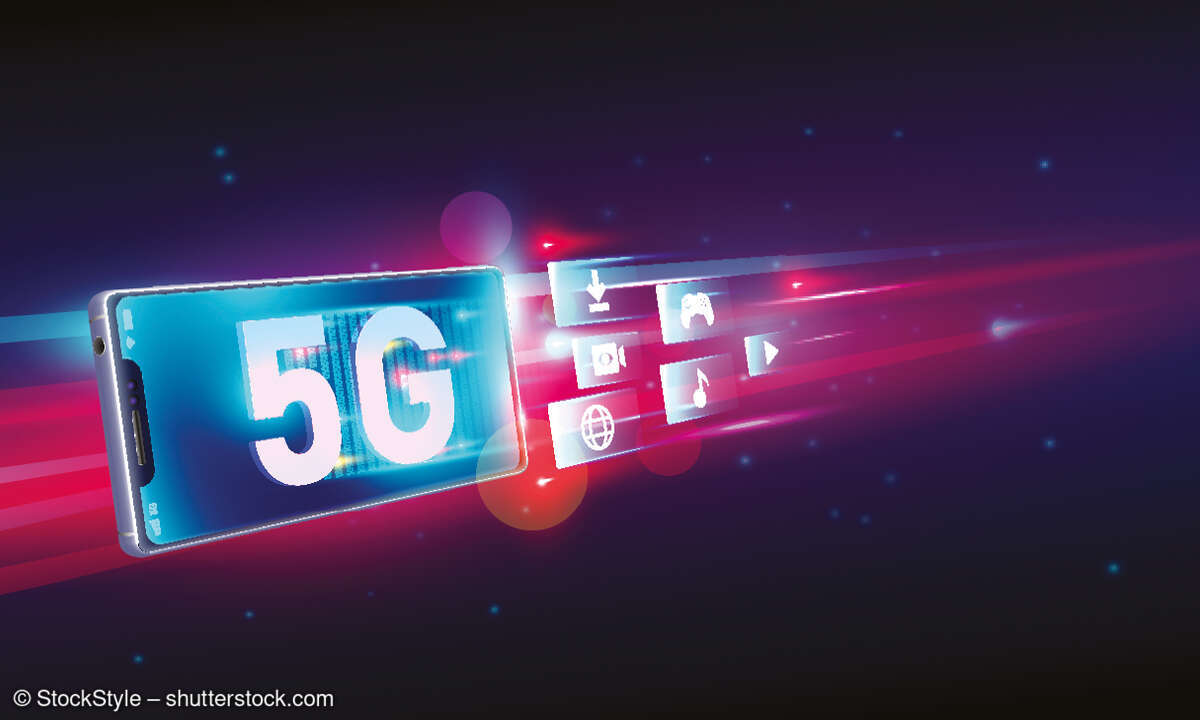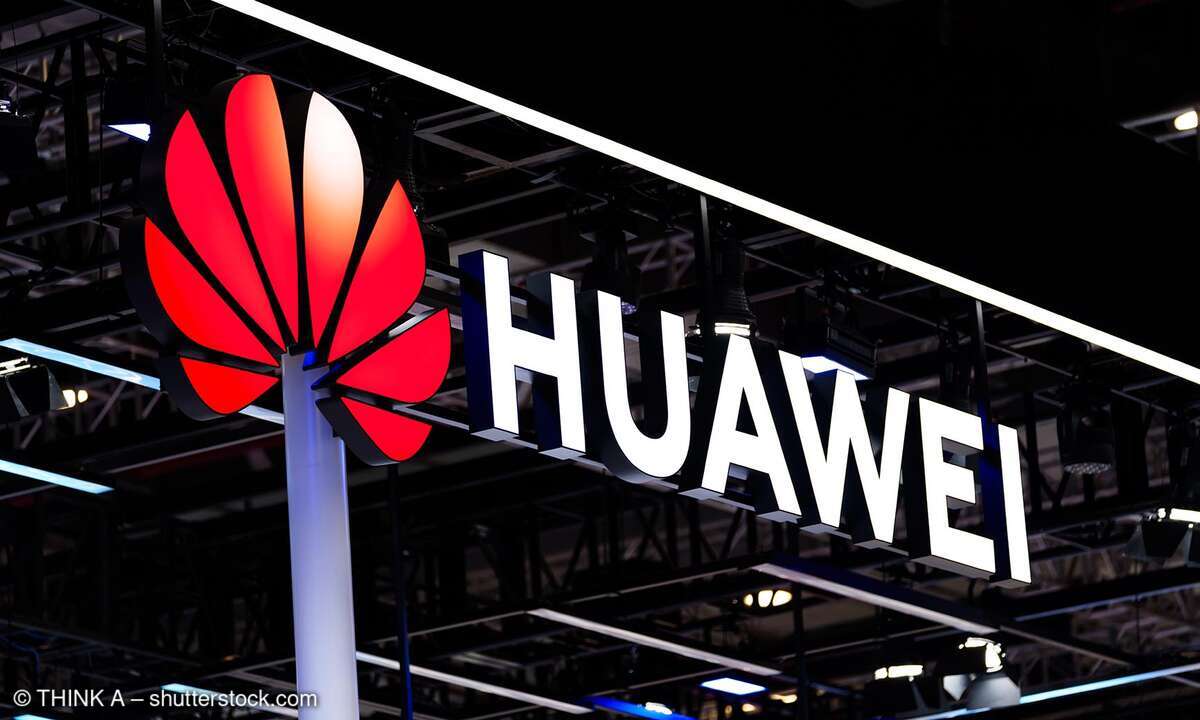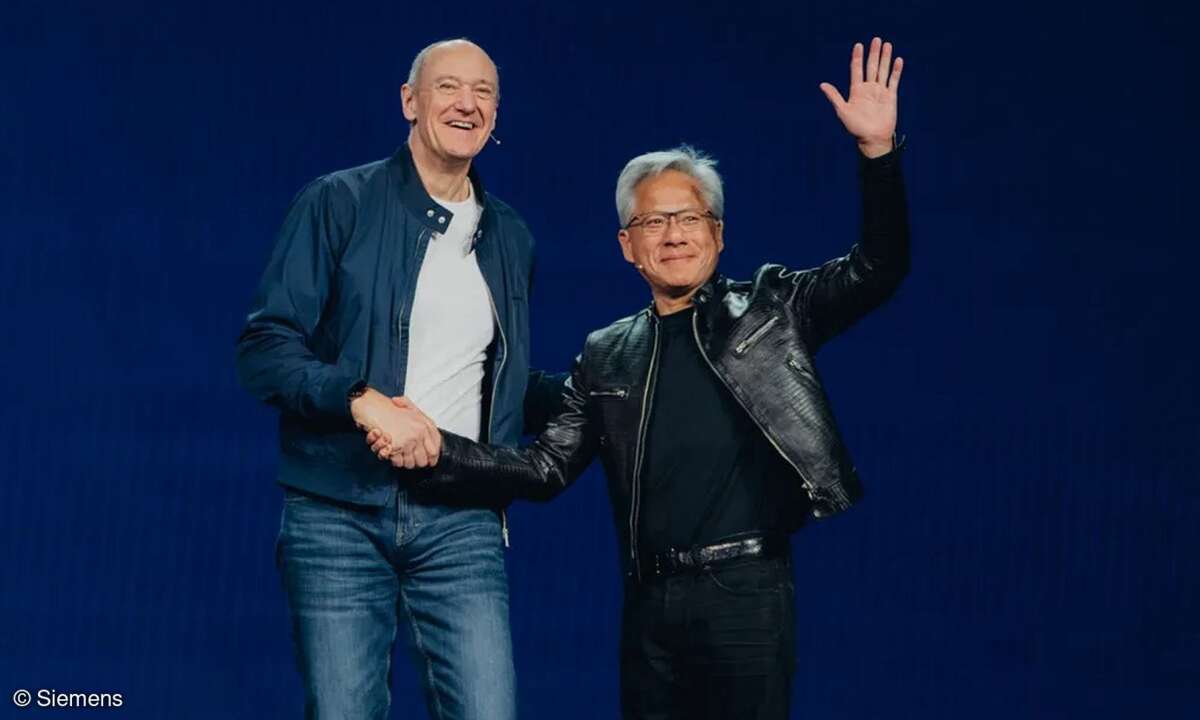5G-Campusnetze: Was Projekte stark macht und woran sie scheitern
Wie wird aus 5G ein echter Produktivfaktor? Was leisten Campusnetze in Werkhallen, Logistikzentren und Co.? Fünf Sessions des Thementags von connect professional machten deutlich: Campusnetze sind keine isolierten Mobilfunkinseln, sondern komplexe Infrastrukturprojekte mit strategischer Reichweite.

Die Diskussion um 5G ist längst aus dem Stadium allgemeiner Visionen herausgewachsen. Doch wie genau gelingt der Schritt von der Idee zur konkreten Anwendung? Beim connect professional-Webinar „5G-Campusnetze“ demonstrierten am 26. Juni Vertreter:innen aus Wissenschaft, Industrie und Technologiepartnern, wie 5G-Campusnetze tatsächlich in Betrieb genommen werden, welche Herausforderungen dabei auftreten und welche strategischen Überlegungen für CIOs, Netzwerkplanerinnen und Prozessverantwortliche heute entscheidend sind.
Fünf Sessions – von Regulierungsrahmen über industrielle Echtzeitszenarien bis hin zu Sicherheitsfragen und Cloud-Edge-Kombinationen – spannten ein praxisnahes Panorama auf, das von über 100 Anmeldungen mit regem Interesse verfolgt wurde. Praxisnahe Erfahrungsberichte lieferten Cocus, Deutsche Bahn, Fraunhofer HHI, Krone Gruppe und m3connect.
Anbieter zum Thema
Vom Regulierungsrahmen bis zum Betrieb: Was 5G heute leisten kann
Den Auftakt machte Prof. Dr.-Ing. Slawomir Stanczak, Leiter des Fachbereichs Drahtlose Kommunikation am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI). Der Experte für drahtlose Kommunikationssysteme umriss die Grundlagen von 5G-Campusnetzen als individuell zugeschnittene, lokale Funknetze mit eigenem Frequenzspektrum, die sich durch niedrige Latenz, hohe Verfügbarkeit und QoS-Mechanismen von klassischen Mobilfunknetzen abgrenzen. „Campusnetze ermöglichen erstmals, sicherheitskritische Echtzeitanwendungen und hochverfügbare Kommunikation in unternehmenseigenem Hoheitsbereich abzubilden“, so Stanczak. Besonders hervor hob er, wie niederschwellig und kostengünstig die Beantragung eigener Frequenzen im Bereich 3,7 bis 3,8 GHz heute sei. „Das Verfahren bei der Bundesnetzagentur ist klar, digitalisiert und auch für kleinere Unternehmen problemlos machbar.“ Diese regulatorische Vereinfachung sei eine wichtige Triebfeder für die zunehmende Verbreitung von Campusnetzen.
Doch Stanczak warnte auch: Standardlösungen nach Blaupause helfen selten. Benötigt seien flexible, integrierbare Architekturen mit praxistauglicher Einstiegshöhe. Gerade kleine und mittlere Unternehmen benötigten schlanke Einstiegsarchitekturen – skalierbar, wirtschaftlich tragfähig und mit niedrigem Integrationsaufwand. Das Förderprogramm CampusOS biete hier einen wichtigen Hebel, müsse aber breiter bekannt gemacht werden.

Zugleich zeichnete er ein differenziertes Bild der Anbieterlandschaft. Neben etablierten Akteuren wie Nokia, Huawei oder Ericsson spiele inzwischen auch Samsung eine wichtige Rolle, vor allem im Bereich softwarebasierter Netzkomponenten. Auch kleinere europäische Anbieter sowie eine neue Generation spezialisierter Systemintegratoren, etwa im Rahmen von CampusOS, träten zunehmend in den Vordergrund. Exemplarisch nannte er Unternehmen wie Xelera, Xantaro oder Capgemini Engineering, die als Bindeglied zwischen Netztechnologie, IT-Integration und branchenspezifischer Prozessberatung agieren.
Stanczak stellte klar: Der wahre Mehrwert entsteht erst durch IT- und OT-Integration. Ohne durchdachte Verzahnung mit Prozessen, Datenarchitekturen und Sicherheitsinfrastruktur laufe 5G Gefahr, lediglich isolierter Datentransporteur zu bleiben. Noch fehlten standardisierte Referenzmodelle, klare Zuständigkeiten und eine „verständliche“ Nutzenkommunikation. Der zentrale Appell: 5G dürfe nicht als isolierte Technologieinsel begriffen werden. „Campusnetze entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie mit Prozessen, IT-Infrastruktur und industriellen Anwendungen verzahnt sind.“
Netzbetrieb bei der Bahn: Ein Fahrplan für Skalierung

Wie eine Umsetzung in der Industrie aussehen kann, zeigten Jens Liebel und Alexander Bentkus von der Deutschen Bahn. Im Werk Krefeld wurde ein industrielles 5G-Campusnetz aufgebaut – mit eigenen Frequenzen und echter Funktionstiefe. Es dient der digitalen Instandhaltung und unterstützt Prozesse wie Fahrzeugdiagnose per App, Sensorüberwachung in Echtzeit oder ortsgenaues Asset-Tracking. Auch in denkmalgeschützten Werkhallen, Unterflurgruben und weitläufigen Außenbereichen liefert das Netz stabile Konnektivität. „Wir haben das Netz mit sechs Radios und zwölf Antennen aufgebaut – trotz Stahlbeton und historischer Bausubstanz“, erläuterte Bentkus. Die größte Herausforderung? „Den ROI im Konzernkontext zu vermitteln und das Netz nicht als technisches Experiment, sondern als Werkzeug für die Produktivität zu positionieren.“
Zu den wichtigsten betrieblichen Learnings zählen die automatisierte Steuerung von Arbeitsprozessen, Videoanalytik in sicherheitskritischen Bereichen und präzise Lokalisierung mobiler Einheiten. Der Aufbau sei zwar technisch machbar, erfordere aber klare Zuständigkeiten auf Seiten der IT, enge Abstimmung mit der Fertigung – und verlässliche Technologiepartner. „Wir brauchen mehr Transparenz und Standardisierung in der Schnittstellenbeschreibung, Gerätekompatibilität und Servicebereitstellung“, so das Zwischenfazit.

In puncto Standardisierung will die Bahn vorangehen: Basierend auf den Krefeld-Erfahrungen ist eine konzernweite Ausschreibung geplant. Wichtig sei dabei, Technologiepartner nicht nur als Lieferanten, sondern als „Lösungsarchitekten“ zu verstehen. Die Anforderungen: modulare Komponenten, Integrationswillen und Mitdenken.
Politisch formulierten Liebel und Bentkus drei zentrale Forderungen: Erstens müssten herstellerübergreifende Standards und Schnittstellen harmonisiert werden. Zweitens brauche es ein interoperables Sicherheitskonzept für kritische Infrastrukturen wie die Bahn. Drittens sollten Industrieinitiativen, Forschung und Netzbetreiber enger verzahnt werden, um aus Leuchtturmprojekten skalierbare Standards zu entwickeln. Darüber hinaus sei eine klare regulatorische Perspektive nötig mit schlanken Prozessen, stabilen Förderrahmen und dem politischen Verständnis, dass Campusnetze betrieblicher Standard statt technischer Ausnahmeerscheinung sein sollten.
Real Talk 5G: Warum Campusnetze keine Produkte sind

Eine besonders praxisnahe Perspektive brachte Justin Eichenlaub, Head of Cellular Solutions bei m3connect, ein. Das Unternehmen hat über 20 Campusnetze realisiert – für Hotelketten, Industrieparks, Campingplätze, Krankenhäuser oder Messen. „Jede Branche hat ihre eigenen Regeln, jeder Kunde seine eigene Erwartung“, so Eichenlaub. Entscheidend sei es, frühzeitig Use Cases zu definieren und das Netz modular darauf abzustimmen. „Viele wollen erstmal nur Connectivity, aber die wahre Power von 5G liegt in der Vernetzung von Prozessen und Geräten“, sagte er. Herausforderungen reichen von falschen Kundenannahmen („Plug-and-Play“-Erwartung) über technische Stolperfallen (inkompatible Geräte, fehlende Spektrumanalyse) bis hin zu Missverständnissen beim Netzdesign. Viele Unternehmen dächten in WLAN-Kategorien, obwohl 5G ein strategisches Infrastrukturprojekt sei. Stattdessen brauche es „strategische Netzarchitekturen, offene Schnittstellen und ein sauberes Lifecycle-Management“.
Was sich in der Theorie einfach anhört, ist in der Praxis oft ein steiler Lernprozess. Eichenlaub berichtete offen von Überraschungen und Missverständnissen in realen Kundenprojekten. Viele Unternehmen setzten große Erwartungen in 5G als Heilsbringer für die Digitalisierung. Aber ein Campusnetz allein mache noch keinen digitalen Prozess. In einem Fall etwa investierte ein Kunde über Monate in Netzaufbau und Schulungen – nur um dann festzustellen, dass die wichtigsten Produktionsmaschinen kein kompatibles Interface boten. „Solche Fälle sind kein Einzelfall.“
Besonders betonte Eichenlaub die Rolle von OpenRAN. Diese biete Unabhängigkeit von proprietären Systemen, sei aber kein Selbstläufer. „Die Herstellerfrage ist wichtig, aber noch wichtiger ist die Fähigkeit, Netzwerke iterativ zu verbessern.“ In seinen Worten: „5G-Campusnetze sind keine Produkte, sie sind Prozesse.“
Ein weiteres Hindernis sei die nach wie vor mangelhafte 5G-Kompatibilität vieler Endgeräte. „Die größte Hürde im laufenden Betrieb ist oft gar nicht das Netz selbst, sondern dass wichtige Maschinen, Handscanner oder Tablets gar kein zertifiziertes 5G-Modul haben oder nicht zuverlässig im privaten Netz funktionieren“, so Eichenlaub. Die Marktdurchdringung geeigneter Hardware hinke dem Netzaufbau deutlich hinterher.
Auch die Erwartung eines Plug-and-Play-Erlebnisses sei weit verbreitet. Doch in Wirklichkeit sei ein Campusnetz ein strategisches Infrastrukturprojekt, das tief in bestehende IT-, OT- und Sicherheitsarchitekturen integriert werden muss. Besonders kritisch sieht Eichenlaub die Tendenz, Campusnetze als symbolische Digitalisierungsprojekte zu inszenieren. „Wir brauchen keine Leuchttürmchen, sondern robuste Basisinfrastrukturen, die echten Mehrwert schaffen.“
Digitalisierung auf dem Hof: Krone denkt 5G weiter
Mit einer industriellen Perspektive meldete sich Agnes Aßbrock, Forschungsprojektmanagerin der Krone Gruppe, zu Wort. Das Unternehmen betreibt in Spelle, Werlte und Lingen eigene Campusnetze und nutzt sie unter anderem für Maschinenlokalisierung, Softwareupdates „over the air“, digitalisierte Hoflogistik und Echtzeitüberwachung von Arbeitsprozessen. Besonders innovativ ist der Einsatz von Drohnen für das Hofmanagement, mobilen Endgeräten für Fahrerassistenzsysteme sowie teilautomatisierten Flurförderfahrzeugen. „All diese Use Cases haben Einfluss auf die Netzarchitektur: Datenraten, Latenzen, Abdeckungsbereiche“, so Aßbrock. Ein entscheidender Aspekt: „5G war für uns kein Selbstzweck.“ Ausschlaggebend war die Möglichkeit, Außenflächen mit anspruchsvoller Funkabdeckung zu versorgen, auch bei Witterung, Bewegung und hoher Gerätedichte. Der Einstieg erfolgte 2021 über ein vom Bund gefördertes Testprojekt. Heute sind die Netze produktiv und integraler Bestandteil der Digitalisierung.
Ein wiederkehrendes Problem sei die Integration geeigneter Endgeräte: „Manche Funktionen – etwa autonome Fahrzeuge oder mobile Assistenzsysteme – erfordern sehr spezifische 5G-Profile. Da stößt man schnell an Grenzen des kommerziellen Geräteangebots.“ Die Marktdurchdringung sei noch nicht auf dem Niveau, das viele Projekte bräuchten.

Ein entscheidender technischer Schritt war die Entscheidung für OpenRAN. „Diese Offenheit gibt uns Spielraum für zukünftige Entwicklungen, reduziert Vendor Lock-in und erleichtert die Integration neuer Services“, sagte Aßbrock. Gleichzeitig verwies sie auf die Bedeutung kontinuierlicher Iteration: „Wir denken das Netz nicht als statische Infrastruktur, sondern als lernendes System, das mit den Anwendungen mitwachsen muss.“
Langfristig sieht Krone 5G als Enabler für noch größere Technologiepakete, etwa in Kombination mit Edge Computing, Cloud-Plattformen und KI. „5G ist kein Ziel, sondern ein Werkzeug“, betonte Aßbrock. „Wir denken schon über 6G, KI-Integration und Cloud-Edge-Kombinationen nach.“ Dennoch sei der Einstieg für viele mittelständische Unternehmen noch zu kompliziert. Ihr Appell: „Es braucht Plug-and-Play-nahe Einstiegspakete, die KMU nicht überfordern.“
Ende-zu-Ende denken: Cocus über Planung, Betrieb und Missverständnisse

Den Schlusspunkt des Thementags setzte Bernd Hoffmann von Cocus mit einem tiefen Einblick in Planung, Betrieb und Sicherheit privater 5G-Netze aus der Perspektive eines Technologiepartners. Für ihn steht fest: „Viele Kunden fragen als erstes nach dem Antennendesign. Aber entscheidend ist, was das Netz eigentlich leisten soll – funktional, wirtschaftlich, sicherheitstechnisch.“ Er plädierte für einen ganzheitlichen Planungsansatz, der alle Ebenen einbezieht: Funktechnik, Geräteklassen, Core-Funktionalität, SIM-Profil-Management, Indoor-/Outdoor-Design und Sicherheitsarchitektur. Gerade Sicherheitsfragen würden oft vernachlässigt.
Hoffmann nutzte die Fragerunde am Ende, um auf verbreitete Missverständnisse hinzuweisen: Viele Kunden nähmen etwa an, dass mit der Installation eines 5G-Netzes automatisch eine durchgängige Netzabdeckung garantiert sei – ohne die notwendige Planung von Endgeräten, Gebäudestrukturen und Netzübergängen. Andere gingen davon aus, dass alle handelsüblichen Geräte automatisch mit privaten 5G-Netzen kompatibel seien oder dass Latenzvorteile ohne Softwareanpassung sofort zur Wirkung kämen. Auch die Vorstellung, ein Campusnetz könne ohne Security-Konzept betrieben werden, sei laut Hoffmann weiterhin verbreitet. „Viele denken, ein Campusnetz sei eine isolierte Technikbox. Aber tatsächlich ist es ein lebendiger Teil der Unternehmens-IT. Ohne Einbindung von Security, Monitoring und Applikationsteam entstehen blinde Flecken.“
Zentrale Stellschrauben, so Hoffmann, seien die Auswahl der Funktechnik – etwa mit Blick auf OpenRAN –, die Architektur des Cores (on-premise oder cloudbasiert), das Sicherheitskonzept (Zugangsmanagement, Verschlüsselung, physische Trennung) sowie das wirtschaftliche Betriebsmodell. Besonders betonte er die Rolle der IT-Abteilungen: „Sie müssen eingebunden sein, denn ein Campusnetz ist keine Insellösung, sondern ein kritischer Teil der digitalen Infrastruktur.“ Ein weiteres Missverständnis sei die Erwartung, dass mit Installation der Hardware bereits Mehrwert entstehe. „Der eigentliche Nutzen kommt über die Applikationen, über die Analyse, die Datenintegration. Daran muss von Anfang an gedacht werden.“
Hoffmanns Schlusswort: Campusnetze ermöglichten neue Geschäftsmodelle – von Drohnenlogistik über Remote Operations bis hin zu datengesteuerten Predictive-Services. Voraussetzung sei allerdings, dass sie sauber geplant, aufgebaut und betrieben würden. 5G-Campusnetze benötigten Planungstiefe, Betriebsexpertise und eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ansonsten werde aus dem Technologieversprechen ein Digitalisierungsfrust.
Keine Leuchttürmchen, sondern strategische Infrastrukturen
Der Thementag zeigte eindrucksvoll: Campusnetze funktionieren nicht „out of the box“. Sie sind keine symbolischen Digitalisierungsprojekte, sondern tiefgreifende Eingriffe in Infrastruktur, Prozesse und Strategien. Erfolgreich sind sie nur dort, wo sie vom Anwendungsszenario her gedacht, integrativ geplant und professionell betrieben werden.
Ob DAX-Konzern, Technologieanbieter oder Mittelstand: Wer 5G wirklich produktiv machen will, muss technologische Vielfalt, Integrationskomplexität und organisatorischen Reifegrad gleichermaßen im Blick behalten. Denn 5G ist kein Produkt. Es ist ein Prozess. Und der entscheidet sich nicht an der Bandbreite – sondern an der Relevanz für reale Prozesse.